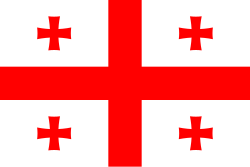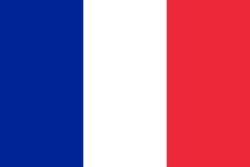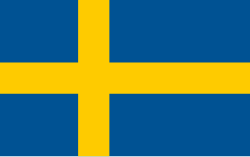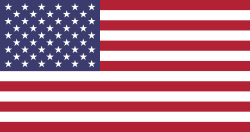Parlamentarische Versammlung der NATO
| Parlamentarische Versammlung der NATO (NATO-PV) | |
|---|---|
 | |
| Rechtsform | Interparlamentarische Organisation |
| Gründung | 1955 |
| Sitz | Brüssel (Belgien) |
| Vorsitz | Marcos Perestrello (Portugal) Präsident Julie Dzerowicz (Kanada) Vizepräsidentin Ágnes Vadai (Ungarn) Vizepräsidentin Johann Wadephul (Deutschland) Vizepräsident Mikko Savola (Finnland) Vizepräsident Alec Shekbrooke (England) Vizepräsident |
| Geschäftsführung | Ruxandra Popa (Frankreich) Generalsekretärin |
| Website | http://www.nato-pa.int/ |

Die Parlamentarische Versammlung der NATO (NATO-PV; englisch NATO Parliamentary Assembly, kurz NATO-PA, französisch Assemblée parlementaire de l’OTAN, kurz AP-OTAN, ehemals Nordatlantische Versammlung) ist eine interparlamentarische Organisation. Seit 1955 bietet sie den Legislativen der NATO-Mitgliedstaaten eine Plattform, um sich über sicherheits- und verteidigungspolitische Themen von gemeinschaftlichem Interesse auszutauschen.
Zu den Zielen der Parlamentarischen Versammlung gehören die Förderung der Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie die Stärkung der transatlantischen Solidarität. Sie ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der NATO und den Parlamenten ihrer Mitgliedstaaten und trägt dazu bei, einen parlamentarischen und öffentlichen Konsens zur Unterstützung der Bündnispolitik zu erreichen.[1] Die Mitglieder beraten und verabschieden Resolutionen, Erklärungen und Berichte mit dem Ziel, die Arbeit der Regierungen der NATO zu beeinflussen. Die Versammlung verfügt dabei nur über beratende Rechte, hat sich aber als ein wichtiges Diskussionsforum im Sicherheitsbereich etabliert. Der NATO-Generalsekretär berichtet der Versammlung schriftlich über die Umsetzung der Forderungen der Versammlung und steht den Mitgliedern Rede und Antwort während den Jahrestagungen oder der Tagungen der Unterausschüsse in Brüssel.[2]
Die Versammlung wird direkt von den Parlamenten der Mitgliedstaaten finanziert und ist somit finanziell und rechtlich unabhängig von der NATO. Der Sitz des internationalen Sekretariats der Versammlung befindet sich in Brüssel.
Geschichte
Die Idee, die Parlamente der NATO-Bündnisstaaten in gemeinsame Beratungen über die Herausforderungen der transatlantischen Partnerschaft einzubeziehen, entstand erstmals Anfang der 1950er Jahre. So fand im November 1951 in Straßburg ein erstes Treffen parlamentarischer Delegationen aus Europa und Nordamerika statt, bei dem amerikanische Senatoren und Kongressabgeordnete mit Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung des Europarates über die Gründung einer Europäischen Union und deren Auswirkungen auf den Westen diskutierten.[3] Als zentrales Ergebnis dieser Gespräche wurde deutlich, dass es nicht mehr möglich war, die Probleme und Perspektiven Europas zu erörtern, ohne gleichzeitig die Probleme und Perspektiven der nordatlantischen Region als Ganzes zu berücksichtigen. Zugleich bestand das Bedürfnis der Parlamentarier, an den grundlegenden Entscheidungen, welche die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der demokratischen Welt betrafen, unmittelbar beteiligt zu werden und damit der Prämisse des Washingtoner Vertrages von 1949 (auch Nordatlantikvertrag genannt), die NATO sei praktischer Ausdruck eines transatlantischen politischen Bündnisses von Demokratien, konkrete Substanz zu verleihen.[4]
Vor diesem Hintergrund trat am 18. Juli 1955 erstmals die Konferenz der Parlamentarier der NATO-Mitgliedstaaten zusammen, aus der anschließend im Jahre 1966 die Nordatlantische Versammlung (NAV) hervorging. 1967 empfahl der Nordatlantikrat (NAC) die Aufnahme informeller Beziehungen zwischen der NATO und der NAV, um eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen zu erreichen. Seither nimmt der NATO-Generalsekretär nach Rücksprache mit dem NAC an den Vollversammlungen teil. Im Gegenzug wendet sich der Präsident der NATO PV an die anlässlich ihrer Gipfeltreffen versammelten Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder.
Als Reaktion auf die historischen Ereignisse zum Ende des Kalten Krieges und ein sich rasch veränderndes Sicherheitsumfeld übernahm die NATO PV eine neue Rolle, als sie 1991 ihr Mandat erweiterte und Parlamenten aus mittel- und osteuropäischen Ländern sowie weiteren Staaten, die engere Beziehungen zur NATO anstrebten, den Status eines assoziierten Mitglieds gewährte. Diese Einbindung leistete wichtige politische und praktische Unterstützung zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie im gesamten euro-atlantischen Raum und zum Aufbau eines stabileren und sichereren Europas.[5]
So spielte die Versammlung auch eine direkte Rolle bei der Unterstützung des Ratifizierungsprozesses der Ende 1997 unterzeichneten Beitrittsprotokolle, die im März 1999 zum Beitritt der Tschechischen Republik, Ungarns und Polens zum Bündnis führten. Dieselbe Funktion übernahm sie auch beim Ratifizierungsprozess, der im März 2004 zum Beitritt Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Rumäniens, der Slowakei und Sloweniens führte, sowie bei allen weiteren Beitritten neuer Mitglieder.
Während der Frühjahrstagung in Warschau im Jahr 1999 wurde die NAV in die Parlamentarische Versammlung der NATO (NATO PV) umbenannt.[6]
Aufgrund der Annexion der Krim hat Russland seinen Status als assoziiertes Mitglied im Frühjahr 2014 verloren.[7]
Zusammensetzung
Die Parlamentarische Versammlung der NATO besteht aus insgesamt 281 Delegierten aus den 32 NATO-Mitgliedstaaten. Hinzu kommen weitere Delegierte aus 8 assoziierten Ländern, 3 NATO-Kandidatenländern, dem Europäischen Parlament, 4 regionalen Partnerländern und assoziierten Mittelmeerländern sowie 7 parlamentarische Beobachter und Vertreter zweier interparlamentarischer Versammlungen (OSZE-PA und PACE). Das Leitungsorgan der Versammlung ist der Ständige Ausschuss, welcher sich aus der Leitung jeder Mitgliedsdelegation, dem/der Präsident/in, den Vizepräsidenten/innen, dem/der Schatzmeister/in und dem/der Generalsekretär/in zusammensetzt.[8]
Die Delegierten sind zumeist Mitglieder in den Ausschüssen für Verteidigung oder für Auswärtige Angelegenheiten der jeweiligen Parlamente, so dass sie bei ihrer Tätigkeit in der NATO PV mit ihren Amtskollegen in Kontakt treten. Die deutsche Delegation in der NATO PV setzt sich aus 18 ordentlichen Mitgliedern (12 Abgeordnete des Deutschen Bundestages und 6 Vertreter des Bundesrates) sowie einer Anzahl von Stellvertreter/innen zusammen.[9] Der Leiter der Delegation des Bundestages ist zugleich Leiter der deutschen Delegation, der Leiter der Bundesratsdelegation ist stellvertretender Leiter. Traditionell sind die Mitglieder des Bundesrates verantwortlich für die jeweiligen Innenressorts der Länder.[10]
| NATO-Staaten | Assoziierte Staaten und Staatenverbunde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | |||
| 7 | 7 | 5 | |||
| 6 | 3 | 5 | |||
| 5 | 5 | 10 | |||
| 18 | 12 | 5 | |||
| 3 | 7 | 3 | |||
| 5 | 10 | 3 | |||
| 18 | 7 | 3 | |||
| 7 | 5 | 5 | |||
| 18 | 3 | 5 | |||
| 3 | 12 | 5 | |||
| 12 | 7 | 12 | |||
| 5 | 18 | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 4 | 18 | ||||
| 3 | 36 | ||||
| gesamt: | 281 | gesamt: | 64 | ||
Präsidenten
 Wishart McLea Robertson (1955–1956)
Wishart McLea Robertson (1955–1956) Wayne Hays (1956–1957)
Wayne Hays (1956–1957) Johannes J. Fens (1957–1959)
Johannes J. Fens (1957–1959) Antoine Béthouart (1959–1960)
Antoine Béthouart (1959–1960) Nils Langhelle (1960–1961)
Nils Langhelle (1960–1961) Pietro Micara (1961–1962)
Pietro Micara (1961–1962) Lord Crathorne (1962–1963)
Lord Crathorne (1962–1963) Georg Kliesing (1963–1964)
Georg Kliesing (1963–1964) Henri Moreau de Melen (1964–1965)
Henri Moreau de Melen (1964–1965) José Soares da Fonseca (1965–1966)
José Soares da Fonseca (1965–1966) Jean-Eudes Dubé (1966–1967)
Jean-Eudes Dubé (1966–1967) Matthías Árni Mathiesen (1967–1968)
Matthías Árni Mathiesen (1967–1968) Kasım Gülek (1968–1969)
Kasım Gülek (1968–1969) Wayne Hays (1969–1970)
Wayne Hays (1969–1970) Romain Fandel (1970–1971)
Romain Fandel (1970–1971) Terrence Murphy (1971–1972)
Terrence Murphy (1971–1972) John Peel (1972–1973)
John Peel (1972–1973) Knud Damgaard (1973–1975)
Knud Damgaard (1973–1975) Wayne Hays (1975–1977)
Wayne Hays (1975–1977) Geoffrey de Freitas (1977–1979)
Geoffrey de Freitas (1977–1979) Paul Thyness (1979–1980)
Paul Thyness (1979–1980) Jack Bascom Brooks (1980–1982)
Jack Bascom Brooks (1980–1982) Peter Corterier (1982–1983)
Peter Corterier (1982–1983) Patrick Wall (1983–1985)
Patrick Wall (1983–1985) Charles Mathias (1985–1986)
Charles Mathias (1985–1986) Ton Frinking (1986–1988)
Ton Frinking (1986–1988) Patrick Duffy (1988–1990)
Patrick Duffy (1988–1990) Charles Grandison Rose (1990–1992)
Charles Grandison Rose (1990–1992) Karsten Voigt (1994–1996)
Karsten Voigt (1994–1996) Rafael Estrella (2000–2002)
Rafael Estrella (2000–2002) Doug Bereuter (2002–2004)
Doug Bereuter (2002–2004) Pierre Lellouche (2004–2006)
Pierre Lellouche (2004–2006) Bert Koenders (2006–2007)
Bert Koenders (2006–2007) José Lello (2007–2008)
José Lello (2007–2008) John S. Tanner (2008–2010)
John S. Tanner (2008–2010) Karl A. Lamers (2010–2012)
Karl A. Lamers (2010–2012) Hugh Bayley (2012–2014)
Hugh Bayley (2012–2014) Mike Turner (2014–2016)
Mike Turner (2014–2016) Paolo Alli (2016–2018)
Paolo Alli (2016–2018) Rasa Juknevičienė (2018)
Rasa Juknevičienė (2018) Madeleine Moon (2018)
Madeleine Moon (2018) Attila Mesterházy (2019–2020)
Attila Mesterházy (2019–2020) Gerry Connolly (2020–2022)
Gerry Connolly (2020–2022) Joëlle Garriaud-Maylam (seit November 2022)
Joëlle Garriaud-Maylam (seit November 2022) Michał Szczerba (2023–2024)
Michał Szczerba (2023–2024) Gerry Connolly (2024–2024)
Gerry Connolly (2024–2024) Marcos Perestrello (seit November 2024)
Marcos Perestrello (seit November 2024)
Ausschüsse
Die Versammlung setzt sich aus fünf Ausschüssen für die zentralen Bereiche der Sicherheit zusammen
- Ausschuss für Verteidigung und Sicherheit
- Ausschuss für Demokratie und Sicherheit
- Ausschuss für Wissenschaft und Technologie
- Ausschuss für Wirtschaft und Sicherheit
- Politischer Ausschuss
die über einen oder mehrere Unterausschüsse verfügen. Sie sind damit beauftragt, sich mit allen wichtigen aktuellen Themen in ihren Bereichen zu befassen. Jedes Jahr finden zwei Tagungen der Vollversammlung – im Frühjahr und im Herbst – in wechselnden Ländern statt. Die Ausschüsse und Unterausschüsse erarbeiten Berichtsentwürfe, die zunächst auf der Frühjahrstagung diskutiert werden. Die Entwürfe werden anschließend überarbeitet und aktualisiert, um dann auf der Jahrestagung im Herbst diskutiert, geändert und verabschiedet zu werden.[11]
Auf der Jahrestagung erarbeiten die Ausschüsse zudem strategische Entschließungsentwürfe, über die das Plenum der Versammlung abstimmt und die bei Annahme als politische Empfehlungen an den Nordatlantikrat oder die Regierungen der Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. Neben den Sitzungen während der Tagungen treffen sich die Ausschüsse und Unterausschüsse zudem mehrmals im Jahr in den Mitglieds- und assoziierten Staaten, wo sie von führenden Regierungs- und Parlamentsvertretern sowie von hochrangigen Wissenschaftlern und Experten über aktuelle Entwicklungen unterrichtet werden.[12]
Zu den weiteren Gremien der Versammlung gehören die Sondergruppe für den Mittelmeerraum und den Nahen Osten zur Förderung des parlamentarischen Dialogs und der Verständigung mit den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas, der Interparlamentarische Ukraine-NATO-Rat sowie der Interparlamentarische Georgien-NATO-Rat.[13]
Der Parlamentarische NATO-Russland-Ausschuss wurde im April 2014 ausgesetzt, nachdem Russland der formale Status in der Versammlung aberkannt worden war.[14]
Ständiger Ausschuss
Der Ständige Ausschuss ist das Leitungsgremium der Versammlung. Er setzt sich zusammen aus
- dem Präsidium der Versammlung (Präsident/in, fünf Vizepräsidenten/innen und Schatzmeister/in)
- den Delegationsleitern der Mitgliedstaaten sowie
- den Vorsitzenden der Ausschüsse
Er tritt während der beiden Tagungen und ein drittes Mal im Frühjahr zusammen. Das Präsidium legt die allgemeinen Leitlinien fest, koordiniert die Arbeiten der Ausschüsse, erstellt die Tagesordnung der Versammlungen und kontrolliert ihre Finanzen. Der/die Generalsekretär/in leitet das Internationale Sekretariat und sorgt für die Umsetzung der vom Ständigen Ausschuss beschlossenen politischen Ziele.[15]
Weblinks
- Homepage der Parlamentarischen Versammlung der NATO (englisch, französisch)
- Überblick zur Parlamentarischen Versammlung der NATO auf bundestag.de
- NATO-Ukraine-Charta (PDF; 24 kB)
Einzelnachweise
- ↑ Dialogue Transparency Partnership: Assembly Leaflet (PDF; 0,3 MB), NATO PA, 21. August 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ In Brussels, North American and European legislators affirm enduring commitment to transatlantic link. NATO PA, 19. Februar 2020, abgerufen am 27. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Sarah Charman and Keith Williams: The Parliamentarians' Role in the Alliance. (PDF) North Atlantic Assembly, 1981, S. 1–2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch).
- ↑ NATO Parliamentary Assembly 1955 -2005 - 50 Years of Parliamentary Diplomacy (PDF; 13 MB), NATO PA, 2005, S. 10–11, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ NATO Parliamentary Assembly 1955 -2005 - 50 Years of Parliamentary Diplomacy (PDF; 13 MB), NATO PA, 2005, S. 8–9, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ The North Atlantic Assembly changes name. NATO, 28. Mai 1999, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch).
- ↑ NATO PA. 30. Mai 2022, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch).
- ↑ Dialogue Transparency Partnership: Assembly Leaflet (PDF; 0,3 MB), NATO PA, 21. August 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ Deutscher Bundestag - Geschichte. Abgerufen am 10. Februar 2025.
- ↑ Parlamentarische Versammlung der NATO. Bunderat, abgerufen am 10. Februar 2025 (deutsch).
- ↑ Dialogue Transparency Partnership: Assembly Leaflet (PDF; 0,3 MB), NATO PA, 21. August 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ Dialogue Transparency Partnership: Assembly Leaflet (PDF; 0,3 MB), NATO PA, 21. August 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ Dialogue Transparency Partnership: Assembly Leaflet (PDF; 0,3 MB), NATO PA, 21. August 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ Rules of Procedure (PDF; 0,4 MB), NATO PA, Mai 2024, S. 2, abgerufen am 10. Februar 2025 (englisch)
- ↑ Deutscher Bundestag - Ziele und Aufgaben. Abgerufen am 10. Februar 2025.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die Europaflagge besteht aus einem Kranz aus zwölf goldenen, fünfzackigen, sich nicht berührenden Sternen auf azurblauem Hintergrund.
Sie wurde 1955 vom Europarat als dessen Flagge eingeführt und erst 1986 von der Europäischen Gemeinschaft übernommen.
Die Zahl der Sterne, zwölf, ist traditionell das Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Nur rein zufällig stimmte sie zwischen der Adoption der Flagge durch die EG 1986 bis zur Erweiterung 1995 mit der Zahl der Mitgliedstaaten der EG überein und blieb daher auch danach unverändert.Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: Foreign and Commonwealth Office, Lizenz: CC BY 2.0
NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference in London, 2 September 2014.
NATO Parliamentary Assembly logo