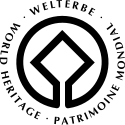Palais Stoclet
| Palais Stoclet | |
|---|---|
| UNESCO-Welterbe | |
| |
| Vertragsstaat(en): | |
| Typ: | Kultur |
| Kriterien: | (i)(ii) |
| Fläche: | 0,86 ha |
| Pufferzone: | 25 ha |
| Referenz-Nr.: | 1298 |
| UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |
| Geschichte der Einschreibung | |
| Einschreibung: | 2005 (Sitzung 29) |
Das Palais Stoclet ist ein repräsentatives Wohnhaus und wurde zwischen 1905 und 1911 nach den Entwürfen des Wiener Architekten Josef Hoffmann errichtet. Der Auftraggeber war der belgische Unternehmer Adolphe Stoclet.[1.1][2.1][3]
Das Palais Stoclet wurde in Zusammenarbeit mit der Wiener Werkstätte und ihr nahe stehenden Künstlerinnen und Künstlern erschaffen und gilt als herausragendes Gesamtkunstwerk im Stile der Wiener Secession.[3][4][5] Damit zählt es „zu den wichtigsten Wohngebäuden des 20. Jahrhunderts.“[6.1] Es befindet sich in der Avenue de Tervueren, 281 (ehemals 303) in Brüssel.[7][2.2]
Architektur
Das Palais Stoclet als Gesamtkunstwerk
Josef Hoffmann gründete 1903 zusammen mit Koloman Moser und Fritz Wärndorfer die Wiener Werkstätte.[8][9] Sie verfolgten den Anspruch, das gesamte Leben im Sinne des Gesamtkunstwerks künstlerisch durchzugestalten.[2] Diese Idee wurde beim Palais Stoclet konsequent durchgeführt.[5]
Das Gesamtkunstwerk, wie es die Wiener Werkstätte verstand, geht auf den Komponisten Richard Wagner zurück, der es 1850 in der Schrift das Kunstwerk der Zukunft definierte. Darin beschrieb Wagner, dass das Gesamtkunstwerk alle Gattungen der Kunst zusammenfassen solle.[10][2.3][6] Im Fall der Wiener Werkstätte wurden Architektur, Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk, Gebrauchsgegenstände und Mode zu einem für sich selbst stehenden Kunstobjekt vereint.[11][12][10.1] Dabei wurden alle Arten der Kunst als gleichwertig empfunden.[13] Außerdem war Zusammenarbeit ein wesentlicher Aspekt des Gesamtkunstwerks.[2.4][12]
Folgende Wiener Künstlerinnen und Künstler waren an dem Projekt beteiligt: Carl Otto Czeschka, Ludwig Heinrich Jungnickel, Berthold Löffler, Leopold Forstner, Richard Luksch, Elena Luksch-Makowsky, Franz Metzner, Koloman Moser, Michael Powolny, Emilie Schleiss-Simandl und Gustav Klimt. Sie alle standen der Wiener Werkstätte nahe, oder waren selbst Mitglieder. Die einzigen belgischen Künstler waren George Minne und Fernand Khnopff.[1][14] Das Palais Stoclet ist also ein „gemeinschaftliches Kunstwerk“[2.5] unter der Leitung Josef Hoffmanns.[2.5] Dabei wurden kostbare und hochwertige Materialien sowie einfache, geometrische Formen verwendet, die sich in allen Elementen des Baus wiederfinden lassen.[15][2.6][16]
Jedes Detail des Palais Stoclets wurde durch die Wiener Werkstätte ausgeführt und an den Bau abgestimmt: von den Utensilien des Badezimmers bis zu Taschentüchern der Hausherrin, die sie an die Krawatten ihres Mannes anpassten.[4][6.2][14.1] Selbst die Kleidung wurde auf das Konzept des Gesamtkunstwerks zugeschnitten. Hoffmann empfand ein Kleid der Ehefrau Stoclets als unpassend für die Ästhetik des Hauses. Er entwarf also kurzerhand ein passendes Gewand.[17] Somit wurde das Leben der Familie Stoclet im Sinne des Gesamtkunstwerks künstlerisch durchgestaltet.
Baukörper, Fassade und Gartenanlage

Der Baukörper misst 60 Meter in der Länge und besteht aus asymmetrisch zusammengefügten Blöcken.[13][3][7] Er zeichnet sich durch seine „geometrische Klarheit“[7] aus und ist nahe der Straße platziert, um möglichst viel Platz für den dahinterliegenden Garten zu bieten.[18] Vergoldete Bronzeleisten rahmen die Wandflächen, die vollständig mit weißen Turili-Marmorplatten aus Norwegen verkleidet sind (Abb. 1).[13.1][7][1.2][6.1] Geometrische Formen schmücken die Leisten. Damit zählen sie zu den wenigen ornamentalen Verzierungen der Fassade (Abb. 3).[19]

Der Hauptbau des Stadtpalastes umfasst drei Stockwerke und ist mit einem Walmdach ausgestattet, das allerdings erst sichtbar wird, wenn man das Gebäude aus größerer Entfernung betrachtet.[20][1.3] Über dem langen und verhältnismäßig niedrigen Hauptbau ragt westlich der fast 20 Meter hohe Treppenturm, der mit vier bronzenen Athletenfiguren von Franz Metzner verziert ist. Der gestufte Turm steht mit seiner Höhe im Gegensatz zu der horizontalen Ausrichtung des 9,60 Meter hohen Hauptbaus.[19.1][6.1][15] Der Treppenturm wird von einer Kuppel ab geschlossen, die von Michael Powolny stammt und sich aus kupfernen Blumen zusammen setzt. Außerdem hat der Turm ein sehr langes Fenster, das das gesamte Treppenhaus belichtet.[7.1][19][3][6.1][2.7][21][22][14.2] Westlich an dem Hauptgebäude befindet sich der niedrigere Wirtschaftsflügel, mit der Zufahrt zu dem Hof. Anstelle eines Walmdachs befindet sich eine Dachterrasse auf diesem Gebäudeteil.[3][1.4][16.1]

Das Gebäude ist durch ein Gitter von der Straße abgrenzt und garantiert so die Privatsphäre.[3][2.8][1.3] In der Mitte des Baus gelangt man durch einen Pavillon über mehrere Stufen zum Haupteingang.[21][2.9] Eine Pallas-Athene-Statue von Michael Powolny bekrönt diesen Pavillon.[2.7] Links neben dem Haupteingang ist ein polygonaler Erker. Ein ähnlicher halbkreisförmiger Vorsprung findet sich an der Ostseite.[1.5][15.1][16.2]
Auf der Gartenseite treten zwei viereckige Vorsprünge aus der Fassade, die bis zum ersten Stock ragen. Sie fassen einen nach innen schwingenden Bereich ein, in dem sich eine Terrasse befindet. An beiden Vorsprüngen ist jeweils ein weiterer, niedrigerer polygonaler Vorsprung. Darauf sind Balkone, die durch die dahinterliegenden Räume erreich bar sind.[3][2.10][21.1]

Die Gartenanlage, die auch von Josef Hoffmann entworfen wurde, ist der geometrischen Gestaltungsweise des Baus angepasst.[13.1][4][23] Während viele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler den Garten mit Skulpturen, Mosaiken, Reliefs und anderen Kunstgegenständen schmückten, entwarf Hoffmann die „Vasen, Pflanzenkübel [und] Gartenmöbel.“[16.3] All diese Elemente wurden aufeinander und auf die übergreifende Gestaltung des Baus abgestimmt.[16.3][18.1]
Der Garten war nicht nur ein ästhetisches Erlebnis, sondern diente auch der sportlichen Betätigung. Beispielsweise hatte die Anlage einen Tennisplatz und ein steinernes Wasserbassin mit einer hohen Fontaine, das als Schwimmbecken diente.[16.4] Das Bassin wird von zwei Pergolen flankiert, die mit ihren quadratischen Pfeilern und ebenso quadratisch gestalteten Bodenbelägen und Gitterdächern die Geometrie des Baus aufgreifen.[2.6] Blickt man durch die westliche Pergola, kann man eine der beiden von Richard Luksch angefertigte Frauenfiguren sehen, die vor einem Gartenhaus platziert wurde.[16.2]
Grundriss, Innenraum und Ausstattung
Die Form, aus der sich der Grundriss zusammensetzt, ist ein Quadrat von 12 mal 12 Metern. Dieses lässt sich im Obergeschoss der Halle wiederfinden und wiederholt sich mehrfach auf der gesamten Fläche des Grundrisses.[2.11][1.6] Der Grundriss ist also ebenfalls an die geometrische Formensprache des Baus angepasst.

Die Funktionen der etwa 40 Zimmer lassen sich in private Wohnräume und repräsentative Empfangsräume unterteilen. Räumlichkeiten wie die Halle, das Musik- und Theaterzimmer oder der Speisesaal im Erdgeschoss waren dem gesellschaftlichen Leben vorgesehen. Der erste Stock beherbergt private Räume, wie Bade,- Ankleide- und Schlafzimmer. Im zweiten Obergeschoss waren die Zimmer für Bedienstete und Gäste.[2.12][22.1][20][6.3][1.7]
Die gesamte Innenausstattung des Palais Stoclet wurde von der Wiener Werkstätte ausgeführt, wobei Josef Hoffmann den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern bei der Gestaltung der Innenräume freie Hand ließ.[22] Jedes Element der Ausstattung ist auf die übergreifende Gestaltung des Stadtpalastes abgestimmt.[4][24] Vornehme Schlichtheit und Eleganz prägen die Innenräume ebenso wie das äußere Erscheinungsbild des Baus.[19] Für die Gestaltung der Innenräume wurden die besten und teuersten Materialien verwendet: Die Wände sind mit Marmor und Wandverkleidungen geschmückt, die Fußböden aus Parkett oder Marmor sind teilweise mit Ornamenten verziert.[3][1.8] Jeder Raum wurde zunächst in Wien zusammengestellt, um dessen Wirkung zu überprüfen und daraufhin nach Brüssel gebracht.[4]
Die Halle, die sich über zwei Stockwerke erstreckt, diente als Ausstellungsort für die um fassende Kunstsammlung der Familie Stoclet.[16.5] Die Sammlung wurde nach dem Tod des Ehepaars Stoclet unter ihren drei Kindern aufgeteilt.[14.1] Die Wände sind mit gelb-grünem Marmor verkleidet und schlanke, regelmäßig angeordnete Marmorpfeiler verbinden die zwei Geschosse der Halle.[19][1.8][16.5][18] Über eine große Treppe aus belgischem Marmor gelangt man in das Obergeschoss, wo sich eine Galerie um die Halle herum befindet, über die die Räume des Obergeschosses zugänglich sind.[20.1][6.2][1.8] Über den Treppenturm waren u. a. die Kinderzimmer erreichbar.[1.7] Eines davon wurde von Ludwig Heinrich Jungnickel mit einem Tierfries geschmückt.[14.3]
Fernand Khnopff hatte die dekorative Ausstattung des Musik- und Theatersaals zur Aufgabe.[25] Der Boden ist aus dunklem Holz und die Wände sind mit schwarzem Marmor verkleidet, die mit vergoldeten Leisten aus Kupfer versehen sind. Die Möbel und Vorhänge sind dagegen rot gefärbt. Tagsüber wird der Raum durch Buntglasfenster von Carl Otto Czeschka beleuchtet.[18.2] Am Ende des Raums erhebt sich eine halbrunde Bühne.[6.3][4] Dort fanden regelmäßig Konzerte statt, da die Stoclets nicht nur an der bildenden Kunst, sondern auch an der Musik interessiert waren.[14.1]
Die Marmorwände des großen Speisesaals sind mit dem berühmten Stoclet-Fries von Gustav Klimt verziert, der den Höhepunkt des Gebäudes darstellt.[4.1][1.9][24.1] Klimt und Hoffmann arbeiteten bei der Gestaltung des Speisesaals eng zusammen, um den Fries und die Einrichtung harmonisch aufeinander abzustimmen.[24]
Eine weitere Besonderheit des Palais Stoclets ist, dass es mit der modernsten Technik für diese Zeit ausgestattet ist. Beispielsweise gab es eine Zentralheizung und eine Staubsaugeranlage.[16.6]
Geschichte
Adolphe Stoclet war ein wohlhabender belgischer Unternehmer.[3] Er und seine Frau Suzanne waren nicht nur sehr interessiert an Kunst, sondern sammelten sie auch.[26][22.2] Aus beruflichen Gründen hielten sie sich zwischen 1903 und 1904 in Wien auf.[26] Auf einem Spaziergang durch Wien fiel ihnen ein Haus auf der Hohen Warte positiv auf. Es gehörte dem Maler und Mitglied der WienerSecession Carl Moll. Moll lud das Ehepaar Stoclet in sein Haus ein und stellte ihnen den Architekten – Josef Hoffmann – noch am selben Tag vor. Die Stoclets planten daraufhin, sich von Hoffmann ein Haus auf der Hohen Warte errichten zu lassen. Es kam jedoch nie dazu, da Adolphe Stoclets Vater 1904 überraschend starb. Stoclet war gezwungen, zurück in seine Heimat Belgien zu reisen, um die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen.[4.2][20][19.2] Auf dem ursprünglich angedachten Grundstück auf der Hohen Warte befindet sich heute ein weiters Bauwerk Hoffmanns, die Villa Ast.[4.2]
Da Stoclet nun an Belgien gebunden war, beschloss er, sich sein Wohnhaus von Hoffmann in Brüssel errichten zu lassen.[6.1] Am 8. April 1905 erwarb Stoclet das Grundstück an der Avenue de Tervueren in Brüssel. Diese Straße war äußerst prestigeträchtig, da sie als Verlängerung der wichtigen Straße Rue de la Loi galt.[21.2] Die Lage war außerdem ideal, da das Grund stück zwar in der Nähe des Stadtzentrums war, gleichzeitig aber einen Ausblick auf das nahe gelegene Tal und einen Wald, den Forêt de Soignes, bot. Damit hatte das Gebäude mitten in Brüssel ein ländliches Flair.[22.3][16.1] Am 2. April 1906 reichte Stoclet schließlich die Baupläne bei der Gemeinde Commune de Woluwe-Saint-Pierre ein und somit begann die Bauzeit.[16.7][18.2]
Die Ausführung des luxuriösen Wohnhauses selbst erfolgte durch die Firma e.d. François et Fils, während die Innenausstattung der Wiener Werkstätte oblag.[26.1] Zum Zeitpunkt der ersten Entwürfe, im Jahr 1905, hatte Hoffmann soeben das Sanatorium Purkersdorf bei Wien fertiggestellt.[1.10] Stoclet ließ Hoffmann sämtliche Freiheiten – auch in finanzieller Hinsicht. Die Kosten des Baus sind nicht bekannt, allerdings berichtete Hoffmann selbst davon, dass die endgültige Summe Nebensache war.[4.2][1.10][13.2] Nach sechs Jahren wurde der Bau schließlich im Jahr 1911 vollendet.[7.2] Die Bauzeit war deshalb so lange, da Hoffmann noch andere Projekte durchführte. Um Hoffmann dazu zu bringen, endlich den Palais zu vollenden, stoppte Stoclet die Honorarzahlung und konnte so die Fertigstellung erzwingen.[26.1] Die Dekoration des Baus wurde allerdings erst 1924 vollständig abgeschlossen.[4]
Am 4. Oktober 1955 wurde in einem feierlichen Akt das 50-jährige Bestehen des Palais Stoclet gefeiert. Hieran nahm der fast 85-jährige Josef Hoffmann als Gast des neuen Hausherrn Jacques Stoclet teil.
Seit 1979 ist das Palais Stoclet denkmalgeschützt, 2005 wurde schließlich auch die Gartenanlage unter Denkmalschutz gestellt.[16.6] Im Juni 2009 wurde das Palais Stoclet zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.[16.6][14.4] Bis 2002 wurde es von den Nachkommen Adolphe und Suzanne Stoclets bewohnt. Seitdem ist es unbewohnt, aber immer noch im Besitz der Stoclets und nicht öffentlich zugänglich (Stand: 2024).[26.2][14.5][16.7] Der gesamte Zustand des Palais Stoclet hat sich seit 1911 kaum verändert (Stand: 2024).[16][14.4] Die größte Veränderung erfuhr das Dach. Ursprünglich war es aus Kupfer, es wurde aber während des ersten Weltkriegs von den deutschen Besatzern eingeschmolzen und durch ein Eternitdach ersetzt.[22.4][15.1]
Literatur
nach Autoren / Herausgebern alphabetisch geordnet
- Hans Ankwicz von Kleehoven: Josef Hoffmann. Das Palais Stoclet in Brüssel. Ein richtungsweisendes Meisterwerk österreichischer Baukunst und Innenausstattung. In: Alte und Moderne Kunst 6, 1961, Heft 42, S. 7–11 (Digitalisat).
- Gabriele Fahr-Becker: Wiener Werkstätte, 1903–1932. Taschen, Köln 2008, ISBN 978-3-8228-3771-9.
- Anette Freytag: Der Garten des Palais Stoclet in Brüssel. Josef Hoffmanns „chef d’œuvre inconnu“. In: Die Gartenkunst, 20, Nr. 1, 2008, S. 1–46.
- Anette Freytag: Der Stocletfries: Ein künstlicher Garten im Herzen des Hauses. In: Tobias G. Natter (Hrsg.): Gustav Klimt. Sämtliche Gemälde. Taschen, Köln 2012, ISBN 978-3-8365-2794-1, S. 100–188.
- Anette Freytag: Das Palais Stoclet in Brüssel vom Garten aus betrachtet. In: ICOMOS, Hefte des deutschen Nationalkomitees, Bd. 64, 2017, S. 221–234. (Digitalisat)
- Friedrich Kurrent, Alice Strobl: Das Palais Stoclet in Brüssel von Josef Hoffmann: mit dem berühmten Fries von Gustav Klimt. Verlag Galerie Welz, Salzburg 1991, ISBN 3-85349-162-6.
- Tobias G. Natter (Hrsg.): Gustav Klimt. Sämtliche Gemälde. Taschen, Köln 2012, ISBN 978-3-8365-2794-1.
- Philippe Roberts-Jones (Hrsg.): Brüssel Fin de Siècle Taschen, Köln 1999, ISBN 3-8228-6935-X, S. 231ff. (Fotos diverser Innenräume: Empfangsraum, kleine Halle, Esszimmer, Musiksalon, Speisesaal)
- Alice Strobl: Zur Geschichte des Stoclet-Frieses 1905–11. In: Gustav Klimt. Die Zeichnungen 1904–1912. Verlag Galerie Welz, Salzburg 1984, ISBN 3-85349-8, S. 139ff.
- Alfred Weidinger: Das Haus Stoclet ist wirklich sehr schön. In: Gustav Klimt. Prestel, München 2007, ISBN 978-3-7913-3763-0, S. 118–137, 289.
- Alfred Weidinger: 100 Jahre Palais Stoclet – Neues zur Baugeschichte und künstlerischen Ausstattung. In: Gustav Klimt und Josef Hoffmann. Pioniere der Moderne. Prestel, München 2011, ISBN 978-3-7913-5148-3, S. 204–251.
Weblinks
- Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
- Link zu den Werkzeichnungen zum Stoclet-Fries Auf: mak.at
Einzelnachweise
- ↑ Friedrich Kurrent, Alice Strobl: Das Palais Stoclet in Brüssel von Josef Hoffmann. Mit dem berühmten Fries von Gustav Klimt. Galerie Welz, Salzburg 1991, ISBN 3-85349-162-6, S. 15 f.
- ↑ Lil Thomas Helle: Stimmung in der Wiener Architektur der Moderne. Josef Hoffmann und Adolf Loos. Böhlau, Wien 2017, ISBN 978-3-205-20527-2, S. 154.
- ↑ a b c d e f g h i Maria-Christina Boerner: Jugendstil. h.f. ullmann, Rheinbreitbach 2019, ISBN 978-3-8480-1166-7, S. 226.
- ↑ a b c d e f g Peter Vergo: Art in Vienna. 1898-1918. Klimt, Kokoschka, Schiele and their Contemporaries. 2. Auflage. Phaidon Press, Oxford 1981, ISBN 0-7148-2222-1, S. 145 f.
- ↑ a b Brandstätter, Christian (Hrsg.): Wien 1900. Kunst und Kultur. Fokus der europäischen Moderne. Dt. Taschenbuchverlag, München 2011, ISBN 3-423-34295-1, S. 185.
- ↑ August Sarnitz: Josef Hoffmann. 1870 – 1965. Im Universum der Schönheit. Taschen, Köln 2007, ISBN 3-8228-5588-X, S. 16 f.
- ↑ a b c d Henry Russell Hitchcock: Die Architektur des 19. Und 20. Jahrhunderts. Aries, München 1994, ISBN 3-920041-41-0, S. 463.
- ↑ Leslie Topp: An Architecture for Modern Nerves: Josef Hoffmann's Purkersdorf Sanatorium. In: Journal of the Society of Architectural Historians. Band 56, Nr. 4. University of California Press, Kalifornien 1997, S. 416 f.
- ↑ Christian Brandstätter: Design der Wiener Werkstätte. 1903-1932. Architektur. Möbel. Gebrauchsgrafik. Postkarten. Plakate. Buchkunst. Glas. Keramik. Metall. Mode. Stoffe. Accessoires. Schmuck. 1. Auflage. Christian Brandstätter, Wien 2003, ISBN 3-85498-124-4, S. 14, 24 ff.
- ↑ Christine Göttler, Peter J. Schneemann, Birgitt Brokopp-Restle, Norberto Gramaccini, Peter W. Marx, Bernd Nicolai (Hrsg.): Reading Room. Re-Lektüren des Innenraums. De Gruyter, Berlin 2019, ISBN 978-3-11-059246-7, S. 93.
- ↑ S. 96
- ↑ Stadthalle Balingen, Peter Noever (Hrsg.): Josef Hoffmann. Ein unaufhörlicher Prozess. Entwürfe vom Jugendstil zur Moderne. Hirmer, München 2010, ISBN 978-3-7774-2891-8, S. 10.
- ↑ a b Barbara Steffen (Hrsg.): Wien 1900. Klimt, Schiele und ihre Zeit. Ein Gesamtkunstwerk. Hatje Cantz, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-7757-2684-9, S. 11.
- ↑ a b Gabriele Fahr-Becker: Jugendstil. Tandem, Rheinbreitbach 2007, ISBN 978-3-8331-3544-6, S. 43.
- ↑ Agnes Husslein-Arco, Alfred Weidinger (Hrsg.): Gustav Klimt. Josef Hoffmann. Pioniere der Moderne. Prestel, München u. a. 2011, ISBN 978-3-7913-5148-3, S. 212.
- ↑ a b Hans Ankwicz Kleehoven: Josef Hoffmann. Das Palais Stoclet in Brüssel. Ein richtungsweisendes Meisterwerk österreichischer Baukunst und Innenausstattung. In: Alte und Moderne Kunst. Band 6, Nr. 42. Kurt Rossacher, Innsbruck 1961, S. 8.
- ↑ a b Anette Freytag: Das Palais Stoclet in Brüssel vom Garten aus betrachtet. In: ICOMOS – Hefte des Deutschen Nationalkomitees. Band 64. Hendrik Bäßler, Berlin 2017, ISBN 978-3-8062-3706-1, S. 221.
- ↑ Rebecca Houze: From Wiener Kunst im Hause to the Wiener Werkstätte: Marketing Domesticity with Fashionable Interior Design. In: Design Issues. Band 18, Nr. 1. MIT Press, Cambridge 2002, S. 18.
- ↑ a b Peter Noever, Valérie Davignon, Anette Freytag, u. a. (Hrsg.): Yearning for Beauty. The Wiener Werkstätte and the Stoclet House. Hatje Cantz, Ostfildern 2006, ISBN 978-3-7757-1778-6, S. 368.
- ↑ a b c d Jean-Michel Leniaud: Jugendstil. Imhof, Petersberg 2010, ISBN 978-3-86568-583-4, S. 143.
- ↑ a b c Jane Kallir: Viennese Design and the Wiener Werkstätte. 1. Auflage. Thames and Hudson, London 1986, ISBN 0-500-27445-2, S. 54.
- ↑ S. 56
- ↑ a b Eduard F. Sekler: The Stoclet House by Josef Hoffmann. In: Douglas Fraser (Hrsg.): Essays in the History of Architecture. Presented to Rudolf Wittkower. Phaidon Press, London 1969, ISBN 978-0-7148-1300-4, S. 230.
- ↑ a b Eduard F. Sekler: Josef Hoffmann. Das architektonische Werk. Monographie und Werkverzeichnis. 2. überarbeitete Auflage. Residenz, Salzburg u. a. 1986, ISBN 3-7017-0306-X, S. 89.
- ↑ Peter Noever, Marek Pokorný (Hrsg.): Josef Hoffmann. Selbstbiographie. Hatje Cantz, Ostfildern 2009, ISBN 978-3-7757-2473-9, S. 132.
- ↑ a b Tobias G. Natter (Hrsg.): Gustav Klimt. Sämtliche Gemälde. Taschen, Köln 2012, ISBN 978-3-8365-2794-1, S. 104.
- ↑ S. 107
- ↑ Victoria Charles, Klaus H. Carl: Wiener Secession. Parkstone International, New York 2012, ISBN 978-1-906981-36-5, S. 152.
- ↑ a b Gustav Klimt. Erwartung und Erfüllung. Entwürfe zum Mosaikfries im Palais Stoclet. In: Christoph Thun-Hohenstein, Beate Murr (Hrsg.): Mak studies. Band 21. Hatje Cantz, Ostfildern 2012, ISBN 3-7757-3305-1, S. 49.
Koordinaten: 50° 50′ 6,9″ N, 4° 24′ 57,64″ O
Auf dieser Seite verwendete Medien
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Stoclet-fries, rechterpaneel, de Omarming (De Vervulling).
Autor/Urheber: Fred Romero from Paris, France, Lizenz: CC BY 2.0
Woluwe-Saint-Pierre. Avenue de Tervueren The luxurious mansion was designed for the Belgian businessman Adolphe Stoclet. Interior design was made by Gustav Klimt and Fernand Khnopff ; the building was a transition between Art Nouveau and Art Deco. Arch. Josef Hoffmann 1905-11.
(c) Photo by PtrQs, CC BY-SA 4.0
Palais Stoclet by Architect Hoffmann, Brussels
Autor/Urheber: Fred Romero from Paris, France, Lizenz: CC BY 2.0
Woluwe-Saint-Pierre. Avenue de Tervueren The luxurious mansion was designed for the Belgian businessman Adolphe Stoclet. Interior design was made by Gustav Klimt and Fernand Khnopff ; the building was a transition between Art Nouveau and Art Deco. Arch. Josef Hoffmann 1905-11.
Autor/Urheber: Busoni, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Palais Stoclet, avenue de Tervuren, n° 279/281 à Woluwé-Saint-Pierre.
Autor/Urheber: Fred Romero from Paris, France, Lizenz: CC BY 2.0
Woluwe-Saint-Pierre. Avenue de Tervueren The luxurious mansion was designed for the Belgian businessman Adolphe Stoclet. Interior design was made by Gustav Klimt and Fernand Khnopff ; the building was a transition between Art Nouveau and Art Deco. Arch. Josef Hoffmann 1905-11.
Stoclet-fries, linker paneel, De verwachting (De danseres).