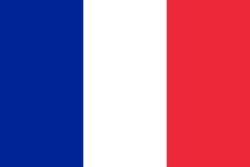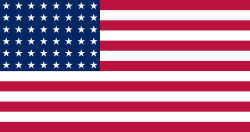Konklave 1939


Das Konklave 1939 tagte in der Zeit vom 1. bis zum 2. März 1939. Es war nötig geworden, nachdem Papst Pius XI. am 10. Februar desselben Jahres gestorben war. Es endete mit der Wahl von Kardinalstaatssekretär und Camerlengo Eugenio Pacelli (an dessen 63. Geburtstag) zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er nahm den Namen Pius XII. an.
Verlauf
Nach dem Tod von Pius XI. rief Kardinaldekan Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte die Kardinäle zum Konklave zusammen. Mit einer Dauer von nur einem Tag mit drei Wahlgängen war es das kürzeste Konklave des 20. Jahrhunderts. Von den 62 wahlberechtigten Kardinälen war jeder anwesend, ein Novum im 20. Jahrhundert.
Im Vorfeld des Konklaves hatten sich England und Frankreich darauf verständigt, die Kandidatur Pacellis, der erkennbar der Wunschnachfolger des verstorbenen Pius XI. war, zu unterstützen. Der französische Botschafter beim Vatikan, François Charles-Roux, sprach mit allen sechs französischen Konklaveteilnehmern und weiteren Kardinälen, von denen er sich eine profranzösische Haltung versprach, im Einzelnen den Kanadier Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, den syrischen Patriarchen Ignatius Gabriel I. Tappouni und den unter dem Franco-Regime ins Exil gegangenen Katalanen Francisco de Asís Vidal y Barraquer, Erzbischof von Tarragona.[1] Sein britischer Amtskollege Sir d’Arcy Osborne kontaktierte den Kardinal von Westminster, Arthur Hinsley.[2] Mit Ausnahme des französischen Kurienkardinals Eugène Tisserant, der Pacelli für unentschlossen hielt und den späteren Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione favorisierte und Hinsley, dem die Intervention seiner Regierung unangenehm war, zeigten die angesprochenen Kardinäle sich gewillt, das Ansinnen der beiden Botschafter zu unterstützen.[3]
Am 2. März 1939, dem Tag des Konklaves selbst, wandten sich die meisten Stimmen schnell dem Favoriten zu. Bereits im zweiten Wahlgang erzielte Pacelli 41 Stimmen, eine weniger als zu einer erfolgreichen Wahl erforderlich.[4] Am Nachmittag erhielt Pacelli dann im dritten Wahlgang 48 Stimmen, also sechs Stimmen mehr als notwendig.[5] Auf die obligatorische Frage des Kardinaldekans, ob er die Wahl annehme, bejahte Pacelli und setzte hinzu: „Domine Iesu, miserere mei“ (Herr Jesus, erbarme Dich meiner).[6]
Pacelli war damit der erste Kardinalstaatssekretär seit 1667 Clemens IX., der zum Papst gewählt wurde, der erste Camerlengo seit Leo XIII. im Jahr 1878, war das erste Mitglied der Kurie seit Gregor XVI. im Jahr 1831 und der erste gebürtige Römer seit Clemens X. im Jahr 1670. Ebenso war es das erste Konklave seit der Wahl Pauls III. im Jahr 1534, das in nur einem Tag abgeschlossen war.
Teilnehmende Kardinäle
Unter den 62 Kardinälen waren auch drei deutsche Kardinäle sowie einer aus Österreich (damals Teil des nationalsozialistischen Deutschen Reichs). Die Anzahl der nicht-europäischen Kardinäle hatte sich auf sieben erhöht.[7]
Die meisten Kardinäle wurden von dem verstorbenen Pius XI. kreiert. Nur zehn Kardinäle hatten bereits am Konklave 1922 teilgenommen.
Während der Sedisvakanz wurden folgende Ämter von diesen Kardinälen ausgeübt:
- Kardinaldekan: Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte
- Kardinalkämmerer: Eugenio Pacelli
- Kardinalsubdekan: Donato Raffaele Sbarretti Tazza
- Kardinalprotodiakon: Camillo Caccia Dominioni
- Anmerkung: (AUT) = zählt heute als Österreicher
 Königreich Italien: Federico Cattani Amadori
Königreich Italien: Federico Cattani Amadori Königreich Italien: Alessio Ascalesi
Königreich Italien: Alessio Ascalesi Spanien: Francisco de Asís Vidal y Barraquer
Spanien: Francisco de Asís Vidal y Barraquer Frankreich: Alfred Baudrillart
Frankreich: Alfred Baudrillart Königreich Italien: Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte
Königreich Italien: Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte Deutsches Reich: Adolf Bertram
Deutsches Reich: Adolf Bertram Königreich Italien: Pietro Fumasoni Biondi
Königreich Italien: Pietro Fumasoni Biondi Königreich Italien: Pietro Boetto
Königreich Italien: Pietro Boetto Königreich Italien: Tommaso Pio Boggiani
Königreich Italien: Tommaso Pio Boggiani Königreich Italien: Nicola Canali
Königreich Italien: Nicola Canali Portugal: Manuel Gonçalves Cerejeira
Portugal: Manuel Gonçalves Cerejeira Argentinien: Santiago Luis Copello
Argentinien: Santiago Luis Copello Königreich Italien: Giovanni Nasalli Rocca di Corneliano
Königreich Italien: Giovanni Nasalli Rocca di Corneliano Königreich Italien: Elia Dalla Costa
Königreich Italien: Elia Dalla Costa Königreich Italien: Carlo Cremonesi
Königreich Italien: Carlo Cremonesi Königreich Italien: Angelo Dolci
Königreich Italien: Angelo Dolci Königreich Italien: Camillo Caccia Dominioni
Königreich Italien: Camillo Caccia Dominioni Vereinigte Staaten: Denis Dougherty
Vereinigte Staaten: Denis Dougherty Königreich Italien: Enrico Gasparri
Königreich Italien: Enrico Gasparri Frankreich: Pierre-Marie Gerlier
Frankreich: Pierre-Marie Gerlier Deutsches Reich: Michael von Faulhaber
Deutsches Reich: Michael von Faulhaber Königreich Italien: Maurilio Fossati
Königreich Italien: Maurilio Fossati Vereinigtes Königreich: Arthur Hinsley
Vereinigtes Königreich: Arthur Hinsley Polen: August Hlond
Polen: August Hlond Deutsches Reich: Theodor Innitzer (AUT)
Deutsches Reich: Theodor Innitzer (AUT) Königreich Italien: Domenico Jorio
Königreich Italien: Domenico Jorio Tschechoslowakei: Karel Kašpar
Tschechoslowakei: Karel Kašpar Königreich Italien: Vincenzo Lapuma
Königreich Italien: Vincenzo Lapuma Königreich Italien: Lorenzo Lauri
Königreich Italien: Lorenzo Lauri Königreich Italien: Luigi Lavitrano
Königreich Italien: Luigi Lavitrano Frankreich: Achille Liénart
Frankreich: Achille Liénart Irland: Joseph MacRory
Irland: Joseph MacRory Königreich Italien: Luigi Maglione
Königreich Italien: Luigi Maglione Königreich Italien: Domenico Mariani
Königreich Italien: Domenico Mariani Königreich Italien: Francesco Marmaggi
Königreich Italien: Francesco Marmaggi Königreich Italien: Massimo Massimi
Königreich Italien: Massimo Massimi Königreich Italien: Giovanni Mercati
Königreich Italien: Giovanni Mercati Vereinigte Staaten: George Mundelein
Vereinigte Staaten: George Mundelein Vereinigte Staaten: William Henry O’Connell
Vereinigte Staaten: William Henry O’Connell Königreich Italien: Eugenio Pacelli (zu Papst Pius XII. gewählt)
Königreich Italien: Eugenio Pacelli (zu Papst Pius XII. gewählt) Königreich Italien: Ermenegildo Pellegrinetti
Königreich Italien: Ermenegildo Pellegrinetti Königreich Italien: Adeodato Giovanni Piazza
Königreich Italien: Adeodato Giovanni Piazza Königreich Italien: Giuseppe Pizzardo
Königreich Italien: Giuseppe Pizzardo Belgien: Jozef-Ernest Van Roey
Belgien: Jozef-Ernest Van Roey Königreich Italien: Raffaele Carlo Rossi
Königreich Italien: Raffaele Carlo Rossi Königreich Italien: Carlo Salotti
Königreich Italien: Carlo Salotti Königreich Italien: Donato Raffaele Sbarretti Tazza
Königreich Italien: Donato Raffaele Sbarretti Tazza Deutsches Reich: Karl Joseph Schulte
Deutsches Reich: Karl Joseph Schulte Königreich Italien: Alfredo Ildefonso Schuster
Königreich Italien: Alfredo Ildefonso Schuster Spanien: Pedro Segura y Sáenz
Spanien: Pedro Segura y Sáenz Ungarn: Jusztinián György Serédi
Ungarn: Jusztinián György Serédi Königreich Italien: Francesco Marchetti Selvaggiani
Königreich Italien: Francesco Marchetti Selvaggiani Königreich Italien: Enrico Sibilia
Königreich Italien: Enrico Sibilia Brasilien: Sebastião Leme da Silveira Cintra
Brasilien: Sebastião Leme da Silveira Cintra Frankreich: Emmanuel Suhard
Frankreich: Emmanuel Suhard Syrien: Ignatius Gabriel I. Tappouni
Syrien: Ignatius Gabriel I. Tappouni Königreich Italien: Federico Tedeschini
Königreich Italien: Federico Tedeschini Frankreich: Eugène Tisserant
Frankreich: Eugène Tisserant Spanien: Isidro Gomá y Tomás
Spanien: Isidro Gomá y Tomás Königreich Italien: Alessandro Verde
Königreich Italien: Alessandro Verde Kanada: Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve
Kanada: Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve Frankreich: Jean Verdier
Frankreich: Jean Verdier
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 113
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 113
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 113–114
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 114
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 115
- ↑ John-Peter Pham: Heirs of the Fisherman, Oxford 2004, S. 115
- ↑ Giancarlo Zizola: Der Nachfolger, Patmos-Verlag 1997, S. 116
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: F l a n k e r, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden.
Autor/Urheber: F l a n k e r, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Flagge des Königreich Italiens (1861-1946) In einem staatlichem oder militärischem Kontext ist die Version mit der Krone zu verwenden.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
Flag of Syria. Originally flag of the Syria Revolution (from 2011), de facto flag of Syria beginning December 2024, official beginning March 2025.
Flag of Syria. Originally flag of the Syria Revolution (from 2011), de facto flag of Syria beginning December 2024, official beginning March 2025.
(c) I, SajoR, CC BY-SA 2.5
Coat of arms of Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli as Camerlengo.
(c) I, SajoR, CC BY-SA 2.5
Emblem of the Holy See when the see is vacant.
Graphic reference:
Flag of Argentina from 1861 to 2010. It is using a 9:14 aspect ratio, which was the norm prior to November 2010.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Bandera del régimen franquista según el escudo adoptado por el Decreto de 2 de febrero de 1938. Más información en [1]
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW