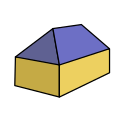Walmdach
Ein Walmdach (früher auch Holländisches Dach[1]) ist eine Dachform, bei der Giebel eines Satteldachs durch je eine weitere Dachfläche (Walm, Schopf) ersetzt werden.[2] Bei einem Dach mit beidseitigem Vollwalm[3] laufen die Dachflächen auf allen Seiten auf ringsum dieselbe Traufhöhe herab. Ist nur auf einer Giebelseite ein Walm vorhanden, heißt es Halbwalmdach. Wenn nur der obere Teil der Giebel abgewalmt ist, ist es ein Krüppelwalmdach (Kurzwalmdach).
Begriff
Der Begriff Walm stammt von mittelhochdeutsch welben mit der Grundbedeutung Wölbung, gewölbter Gegenstand[4] ab und deutet auf frühe Formen des Satteldaches mit gewölbten Dachflächen anstelle des Giebels.[5]
Das Keildach ist ein besonders steil ausgebildetes Walmdach, das vor allem als Turmhelm verwendet wird.
Grundformen der Walmdächer
- Mittelalterhaus mit Walmdach und Eulenloch, 1367 (Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim)
- Goethes Gartenhaus, Weimar
- Typisch nordholländischer Bauernhof mit Walmdach. Das Zwerchhaus weist einen Krüppelwalm auf
- Modernes Walmdach-Wohnhaus in Bad Zwischenahn, Niedersachsen
- (c) 1950s bungalow by Bob Harvey, CC BY-SA 2.0Mehrflügeliger Bungalow mit Walmdächern
- Klassizistische Dreiflügelanlage mit Walmdächern (Schloss Neuhardenberg)
- Keildach als steile Form des Walmdachs (Sebastianskapelle, St. Marein)
- Abgewalmtes Bohlendach, 1803 (Dorfkirche Jabel)
- Mansardwalmdach (Schloss Burkersdorf)
Krüppelwalm, Schopfwalm (Schopfdach), Halbwalm, Kurzwalm
Wenn der Giebel nicht vollständig abgewalmt ist, so ist er je nach Sichtweise nicht vollständig ausgebildet, d. h. verkrüppelt, oder er hat einen Schopf. Ein solcher Halbwalm oder Kurzwalm wird daher Schopfwalm oder Krüppelwalm (norddeutsch Kröpelwalm) genannt.[6]
Manchmal wird ein Schopfwalmdach auch mit einem Fußwalmdach gleichgesetzt.[7]
- Schopfwalm bei einem Firstpfostenhaus (Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim)
- Satteldach mit Halbwalm (Beispiel aus Frankreich)
- Barockbau mit Halbwalmdach (Stettfeld)
- Mansarddach mit Halbwalm (Huttenburg Altengronau)
- Bohlendach mit Halbwalm (Fleether Mühle)
Fußwalm
Ist nur der untere Teil des Daches abgewalmt (sodass ein Giebel im oberen Teil entsteht), wird dieser als Fußwalm bezeichnet.
- Fußwalm
- Traditionelle koreanische Fußwalm-Dachform
- Fußwalmdach auf Sumatra
- Traditionelle Fußwalmdächer slowakischer Berggebiete im zum UNESCO-Welterbe erhobenen Dorf Vlkolínec
- „Wollmdach“ der Zipser Sachsen und anderer „Zipser Häuser“, in slowakischen Bergregionen über die Zips hinaus traditionell.
Niedersachsengiebel, Kärntner Schopf
Der Niedersachsengiebel ist ein Walm, der oben unter dem First beginnt und unten über der Traufkante endet. → Hauptartikel: Niedersachsengiebel
In Österreich ist die Bezeichnung Kärntner Schopf(walm) gebräuchlich.[8]
- Niedersachsengiebel bei einem Fachhallenhaus von 1798 (Heidemuseum Rischmannshof)
- Kärnter Schopfwalm (Maria Saal)
Walmdächer mit Spitze
Ein Walmdach hat in der Regel einen Dachfirst. Der Sonderfall eines Walmdachs, bei dem sich alle Dachflächen ohne First in einer gemeinsamen Spitze berühren, wird bei geringer Dachneigung als Zeltdach und bei steiler Dachneigung als Pyramidendach oder Helmdach (Turmdach) bezeichnet.
Ist der Grundriss der Dachfläche rund, so ergibt sich kein Walmdach, sondern ein Kegeldach, wenn das Dach ringsum geradlinig auf eine Spitze zuläuft. Ist die Dachfläche gewölbt, so spricht man von Dachhaube.
Konstruktion
Die Dachkonstruktion eines Walmdachs ist aus dem Satteldach mit aneinander gereihten Dachsparren entwickelt, wobei an den Ecken Gratsparren gebildet werden, an die Gratschifter als spezielle Dachsparren schräg (geschiftet) anschließen. Die Gratsparren bewirken eine statische Aussteifung des Dachwerks in Längsrichtung.[9] Außer dieser Längsaussteifung bieten abgewalmte Dächer auch weniger Angriffsfläche für Windlasten.
Schon in der historischen Baufachliteratur werden die baukonstruktiven Vorteile der Walmdächer beschrieben. So betont Johann Georg Krünitz in seiner Oeconomischen Encyclopädie (1776):
„Ein holländisches Dach, auch Walm= oder Zelt=Dach (…) ist sehr brauchbar, auf freystehende Gebäude zu setzen, weil das Wetter einem solchen Dache wenig Schaden zufügen kann, so aber bey einem Hause, welches freystehende Giebel hat, nicht Statt findet. Dergleichen Walmdach dient daher auch zur Conservation eines Hauses. Die zweyte Art, nämlich halbe Walmen, welche auf beyden Seiten nur halbe Giebel haben, worauf die Walmenzwickel liegen; dergleichen Dächer verstellen ein Gebäude nicht, und sind ebenfalls dauerhafter, als die geraden oder gemeinen Dächer. Daher kann man solche auch auf Scheunen und Ställe setzen; auch auf Gebäude, die nur ein einziges Stockwerk haben, damit man in das Dach auch Dachstuben anbringen könne, da denn die Fenster durch den halben Giebel gehen.“[1]
- Dachwerk eines strohgedeckten Vollwalms von innen (historisch, Dänemark)
- Inneres eines historischen Walmdachs von einer Gratecke mit Gratsparren und Gratschifter (Allodium Cronheim, 1749)
Siehe auch
Literatur
- Marc Hirschfell: Das ist das Haus vom Nikolaus: Die Geschichte des Walmdachhauses als Urform und Idealtyp. 2005, DNB 988835487, II. Das Walmdachhaus. 4. Bautechnik und Konstruktion, S. 60 ff., doi:10.25673/2329, urn:nbn:de:gbv:3-000013048 (uni-halle.de [PDF; 90,2 MB] Halle (Saale), Univ., Diss., 2005).
Weblinks
- Literatur von und über Walmdach im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Einzelnachweise
- ↑ a b Dach. Kap.: Ein holländisches Dach, auch Walm- oder Zelt-Dach genannt. In: Johann Georg Krünitz: Oeconomische Encyclopädie. Band 8. Berlin 1776, S. 516.
- ↑ Dachformen. In: Hans Koepf, Günther Binding: Bildwörterbuch der Architektur. Mit englischem, französischem, italienischem und spanischem Fachglossar (= Kröners Taschenausgabe. Band 194). 4., überarbeitete Auflage. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-19404-X, S. 116 (moodle.unifr.ch [PDF; 14,7 MB]; abgerufen am 27. September 2024).
- ↑ Thomas Eißing u. a.: Vorindustrieller Holzbau. Terminologie und Systematik für Südwestdeutschland und die deutschsprachige Schweiz (= Südwestdeutsche Beiträge zur historischen Bauforschung. Sonderband). 2., überarbeitete Auflage. Universität Heidelberg / Universitätsbibliothek, Heidelberg 2023, ISBN 978-3-96929-223-5, S. 105, doi:10.11588/sbhbf.2023.1 (uni-heidelberg.de, abgerufen am 27. September 2024).
- ↑ walm, walben, walbe. In: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Hrsg.): Deutsches Wörterbuch. Band 27: W–Weg[zwitschern]-zwiesel – (XIII). S. Hirzel, Leipzig 1922, Sp. 1315 (woerterbuchnetz.de).
- ↑ Marc Hirschfell: Das ist das Haus vom Nikolaus: Die Geschichte des Walmdachhauses als Urform und Idealtyp. 2005, DNB 988835487, II. Das Walmdachhaus. 3. Die ersten Häuser, S. 52 ff., doi:10.25673/2329, urn:nbn:de:gbv:3-000013048 (uni-halle.de [PDF; 90,2 MB; abgerufen am 3. Oktober 2024] Halle (Saale), Univ., Diss., 2005).
- ↑ Walmdach. In: Architekturlexikon, abgerufen am 7. Mai 2025.
- ↑ Dachformen. In: DachdeckerWiki.de, 20. Februar 2018, abgerufen am 7. Mai 2025.
- ↑ Christian Brandstätter: Leben unterm kühlen Kärntner Schopf. In: kleinezeitung.at. 23. September 2023, abgerufen am 27. September 2024.
- ↑ Marc Hirschfell: Das ist das Haus vom Nikolaus: Die Geschichte des Walmdachhauses als Urform und Idealtyp. 2005, DNB 988835487, II. Das Walmdachhaus. 4. Bautechnik und Konstruktion, S. 60, doi:10.25673/2329, urn:nbn:de:gbv:3-000013048 (uni-halle.de [PDF; 90,2 MB; abgerufen am 3. Oktober 2024] Halle (Saale), Univ., Diss., 2005).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Herzi Pinki, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Der quadratische Bau der Sebastianskapelle mit dem hohen Keildach stammt aus der Zeit um 1490. Sie steht am Kirchhof von Sankt Marein im Mürztal.
Autor/Urheber: Twdk, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Details from the mill from Ellested Parish, Fyn, at the Open-Air Museum.
Autor/Urheber: Tilman2007, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Freilandmuseum Bad Windsheim Nr. 104 Firstpfostenhaus
Heidemuseum Walsrode Rischmannshof
Autor/Urheber: Johann Jaritz, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Bauernhaus Nr. 56 Schneidersimele in Maria Saal, Marktgemeinde Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten, Österreich
Autor/Urheber: Markus Schäfer, Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Innenansicht Walmdaches
Autor/Urheber: Ikiwaner, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Bauernhaus in Dotzigen, Schweiz
Autor/Urheber: EdwinH, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Stolpboerderij uit 1913 met bijbehorend hek. Het geheel is rijksmonument
Autor/Urheber:
- Walmdach.png: Shannon
- derivative work: Malyszkz (talk)
Walmdach. Im Gegensatz zum Satteldach hat ein Walmdach nicht nur auf der Traufseite, sondern auch auf der Giebelseite (das ist die kurze Seite des Hauses) geneigte Dachflächen. Sie werden als Walm bezeichnet.
Autor/Urheber: Emmaus in der Wikipedia auf Deutsch, Lizenz: Attribution
Huttenburg in Altengronau
Autor/Urheber: JoachimKohler-HB, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Wohnhaus mit Garten in Bad Zwischenahn
Autor/Urheber: Stilfehler, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Ein Mansarddach, bei dem alle vier Dachflächen abgeknickt sind.
Autor/Urheber: Tilman2007, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Freilandmuseum Bad Windsheim Nr. 95 Bauernhaus aus Höfstetten
© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Goethes Gartenhaus
Autor/Urheber: Doris Antony, Berlin, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Evangelische Dorfkirche in Heiligengrabe-Jabel in Brandenburg, Deutschland
Autor/Urheber:
- Krüppelwalmdach.png: Shannon
- derivative work: Malyszkz (talk)
Krüppelwalmdach
(c) 1950s bungalow by Bob Harvey, CC BY-SA 2.0
1950s bungalow
Autor/Urheber: Stephan van Helden, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Ehemaliges Pfarrhaus, zweigeschossiger und giebelständiger Halbwalmdachbau mit profilierten Rahmungen, 17./18. Jhd. Hauptstraße 25, Stettfeld.
Autor/Urheber: by david&alina at Flickr, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Hahoe Folk Village, Andong, South Korea.
Autor/Urheber: MesserWoland, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Diese W3C-unbestimmte Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt .
Autor/Urheber: Elmar Nolte, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Viergeschossiges Mansardwalmdach am Schloss Burkersdorf
Autor/Urheber: Falk2, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Markt, Nordseite; die Anzahl der Fenster nebeneinander zeigte den Stand des Hausbesitzers an. Einem Bauern standen zwei zu, einem Bürger drei. Alles, was vier und mehr Fenster in einer Reihe hat, wurde von Angehörigen des Adels gebaut (bauen gelassen). Die Größe der Fenster ließ dagegen auf die Vermögensverhältnisse schließen. Die Grundsteuer wurde nach der Länge der Straßenfront berechnet, deshalb sind die meisten Grundstücke schmal, aber lang.
Autor/Urheber: A.Savin, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Schloss Neuhardenberg in Brandenburg; Nordfassade
Autor/Urheber: Thaler Tamas, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Dieses Bild zeigt das in der Slowakei unter der Nummer 508-2843/1 (other) denkmalgeschützte Objekt auf der Seite des Denkmalamtes (engl.) The Monuments Board of the Slovak Republic.