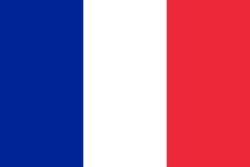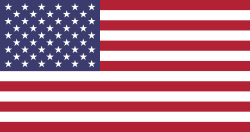Großer Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen
| Großer Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen | |
| Radrennbahn | Radrennbahn Verein Sportplatz Leipzig (bis 1938), Aschenbahn des Stadions Probstheida (1948 bis 1950), Radrennbahn Leipzig (ab 1951) |
| Stadt | Leipzig |
| Austragungsland | |
| Austragungszeitraum | 1905–2009 |
| Wettbewerbe | Steherrennen |
| Gesamtlänge | 50–100 Kilometer |
Das Radrennen Großer Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen war eine Radsportveranstaltung in der sächsischen Stadt Leipzig. Es war ein Wettbewerb im Bahnradsport, der als Steherrennen ausgetragen wurde.
Geschichte
Der Große Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen (auch Preis der Stadt Leipzig) wurde 1905 in der Hochzeit der Steherrennen in Deutschland zum ersten Mal ausgetragen. Viele der späteren Sieger wurden in ihrer Laufbahn als Steher Weltmeister und Europameister.[1] Veranstaltungsorte waren verschiedene Radrennbahnen in Leipzig.[2]
Das Rennen variierte in der Distanz im Lauf der Jahre. Bis 1958 wurden 100 Kilometer oder 75 Kilometer im Finale, ab 1960 50 Kilometer gefahren. In einigen späteren Jahren waren es auch wieder 75 Kilometer. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg unterbrachen jeweils die Tradition des Rennens. 1924 wurde das Rennen nicht ausgetragen, obwohl die Fahrer vor Ort waren, finanzielle Streitigkeiten führten zu einer Absage. Von 1948 bis 1950 fand ersatzweise ein Zweier-Mannschaftsfahren als Großer Preis statt, da Leipzig zu dieser Zeit über keine geeignete Bahn für Steherrennen verfügte.[2] 1970 verhinderte ein Dauerregen das Rennen. Die Stadt Leipzig zahlte bis 1913 dem Gewinner des Rennens mit 3.000 Mark in Goldstücken das höchste Preisgeld, das bis dahin weltweit im Steherrennen ausgelobt worden war.[3]
Der Große Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen war von 1905 bis 1938 für Berufsfahrer offen, ebenso die Ersatzveranstaltung von 1948 bis 1950. Von 1951 bis 1992 starteten nur Amateure, ab 1993 Radrennfahrer der Eliteklasse. Ab 1951 wurde der Große Preis in der Regel in mehreren Läufen ausgetragen. In den 1960er Jahren fand das Finale dann über 50 Kilometer statt.[4]
Die Bahn, die 1951 den Namen Alfred-Rosch-Kampfbahn erhielt, wurde 1994 in Leipziger Radrennbahn umbenannt, der Name Radrennbahn Leipzig setzte sich aber als Bezeichnung durch.[5] Im Jahr 2008 war der Große Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen mit der 79. Ausgabe das älteste noch ausgetrage Steherrennen der Welt.
Der Große Preis war auch von schweren Stürzen nicht verschont. 1906 kollidierte Thaddäus Robl mit dem Schrittmacher von Henri Contenet und stürzte schwer. Dabei erlitt er vielfache Knochenbrüche. 1967 wurde der Wettbewerb nach einem schweren Sturz von Michail Markow bei Kilometer 52 abgebrochen. Markow und vier Zuschauer wurden dabei zum Teil schwer verletzt und Markow zum Sieger deklariert.[3]
Von 1923 bis 1928 wurde auch ein Großer Preis der Stadt Leipzig im Sprint ausgetragen. Zu den Siegern gehörten Robert Spears, Lucien Michard, Avanti Martinetti und Ernst Kaufmann. Der Große Preis der Stadt Leipzig im Steherrennen hatte 80 Austragungen.
Palmarès
- 1905
 Piet Dickentman
Piet Dickentman - 1906
 Piet Dickentman
Piet Dickentman - 1907
 Peter Günther
Peter Günther - 1908
 Arthur Vanderstuyft
Arthur Vanderstuyft - 1909
 Paul Guignard
Paul Guignard - 1910
 Paul Guignard
Paul Guignard - 1911
 Peter Günther
Peter Günther - 1912
 Peter Günther
Peter Günther - 1913
 Robert Walthour
Robert Walthour - 1914
 Karl Saldow
Karl Saldow - 1915–1918 nicht ausgetragen
- 1919
 Karl Saldow
Karl Saldow - 1920
 Karl Wittig
Karl Wittig - 1921
 Emil Lewanow
Emil Lewanow - 1922
 Emil Lewanow
Emil Lewanow - 1923
 Jean Rosellen
Jean Rosellen - 1924 nicht ausgetragen
- 1925
 Walter Sawall
Walter Sawall - 1926
 Gustave Ganay
Gustave Ganay - 1927
 Karl Saldow
Karl Saldow - 1928
 Paul Krewer
Paul Krewer - 1929
 Emil Lewanow
Emil Lewanow - 1930
 René Paul Maronnier
René Paul Maronnier - 1931
 Hermann Hille
Hermann Hille - 1932
 Hermann Hille
Hermann Hille - 1933
 Erich Metze
Erich Metze - 1934
 Hermann Hille
Hermann Hille - 1935
 Erich Metze
Erich Metze - 1936
 Erich Metze
Erich Metze - 1937
 Erich Metze
Erich Metze - 1938
 Walter Lohmann
Walter Lohmann - 1939–1947 nicht ausgetragen
- 1948
 Rudi Mirke/Hans Preiskeit
Rudi Mirke/Hans Preiskeit - 1949
 Rudi Mirke/Hans Kaune
Rudi Mirke/Hans Kaune - 1950
 Willy Gruß/Heinz Günther
Willy Gruß/Heinz Günther - 1951
 Fritz Heinrich
Fritz Heinrich - 1952
 Gerd Thiemichen
Gerd Thiemichen - 1953–1954 nicht ausgetragen
- 1955
 Bruno Zieger
Bruno Zieger - 1956
 Fritz Heinrich
Fritz Heinrich - 1957
 Bruno Zieger
Bruno Zieger - 1958
 Fritz Heinrich
Fritz Heinrich - 1959
 Heinz Wahl
Heinz Wahl - 1960
 Georg Stoltze
Georg Stoltze - 1961
 Rudi Mähl
Rudi Mähl - 1962–1964 nicht ausgetragen
- 1965
 Egon Adler
Egon Adler - 1966
 Egon Adler
Egon Adler - 1967
 Michail Markow
Michail Markow - 1968
 Michail Markow
Michail Markow - 1969
 Erhard Hancke
Erhard Hancke - 1970 nicht ausgetragen
- 1971
 Willi Czudeck
Willi Czudeck - 1972
 Wolfgang Schmelzer
Wolfgang Schmelzer - 1973
 Benny Herger
Benny Herger - 1974
 Michail Markow
Michail Markow - 1975
 Karl Kaminski
Karl Kaminski - 1976–1979 nicht ausgetragen
- 1980
 Günter Gottlieb
Günter Gottlieb - 1981
 Günter Gottlieb
Günter Gottlieb - 1982
 Günter Gottlieb
Günter Gottlieb - 1983
 Ronald Hempel
Ronald Hempel - 1984
 Günter Gottlieb
Günter Gottlieb - 1985
 Jens Kunath
Jens Kunath - 1986
 Jörg Flohrer
Jörg Flohrer - 1987
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1988
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1989
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1990
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1991
 Holger Ehnert
Holger Ehnert - 1992
 Carsten Podlesch
Carsten Podlesch - 1993
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1994
 Jens Veggerby
Jens Veggerby - 1995
 Carsten Podlesch
Carsten Podlesch - 1996
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1997 nicht ausgetragen
- 1998
 Ralf Keller
Ralf Keller - 1999
 Ralf Keller
Ralf Keller - 2000
 Hanskurt Brand
Hanskurt Brand - 2001
 Carsten Podlesch
Carsten Podlesch - 2002
 Stefan Klare
Stefan Klare - 2003
 Carsten Podlesch
Carsten Podlesch - 2004
 Peter Jörg
Peter Jörg - 2005
 Timo Scholz
Timo Scholz - 2006
 Timo Scholz
Timo Scholz - 2007
 Florian Fernow
Florian Fernow - 2008
 Timo Scholz
Timo Scholz - 2009
 Timo Scholz
Timo Scholz
Einzelnachweise
- ↑ Fredy Budzinski: Taschen Rad-Welt. Ein radsportliches Lexikon. Verlag der Rad-Welt, Berlin 1921, S. 102.
- ↑ a b Auf den Spuren der historischen Radsportstätten in Leipzig. Abgerufen am 25. Januar 2025.
- ↑ a b Zur Geschichte des Preises der Stadt Leipzig. Abgerufen am 25. Januar 2025.
- ↑ Deutscher Radsport-Verband der DDR (Hrsg.): Der Radsportler. Nr. 27/1974. Berlin 1974, S. 2.
- ↑ Chronologie der Geschichte der Leipziger Radrennbahn. Aufstieg, Glanzzeit und Niedergang einer einmaligen Leipziger Sportstätte. Abgerufen am 25. Januar 2025.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of the Germans(1866-1871)
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik, vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990
Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.

Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
National- und Handelsflagge des Deutschen Reiches von 1935 bis 1945, zugleich Gösch der Kriegsschiffe.
Das Hakenkreuz ist im Vergleich zur Parteiflagge der NSDAP um 1/20 zum Mast hin versetzt.
Erkennungsflagge für deutsche Handelsschiffe in den Jahren 1946 bis 1950.