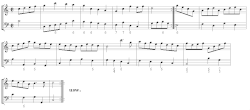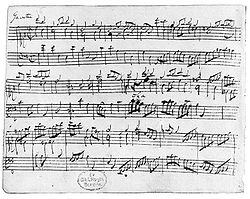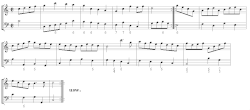Gavotte

Die Gavotte (italienisch: Gavotta; englisch: Gavot) ist ein französischer Tanz im geraden Allabreve- oder 2/2-Takt. Charakteristisch ist ein halbtaktiger Auftakt, häufig in Form von zwei Vierteln. Die Gavotte läßt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und wird in Volkstanzversionen noch heute in einigen Regionen Frankreich getanzt. Schon im 16. Jahrhundert wurde sie auch am Hof beliebt und wurde in Gesellschafts- und Bühnentanzformen bis ins 19. Jahrhundert hinein gepflegt. Sie war häufig Bestandteil der barocken Suite.
„...Ihr Affekt ist wircklich eine rechte jauchzende Freude. Ihre Zeitmaaße ist zwar gerader Art; aber kein Vierviertel-Tact; sondern ein solcher, der aus zween halben Schlägen bestehet; ob er sich gleich in Viertel, ja gar in Achtel theilen läßt. Ich wollte wünschen, dass dieser Unterschied ein wenig besser in Acht genommen würde,...“
Herkunft des Wortes
Michael Praetorius’ Werk Terpsichore (1612) beschreibt den Ursprung der Gavotte als einen Tanz der Bauern (Gavots genannt) aus der Alpenregion nahe Gap im südöstlichen Frankreich. Eine alternative Erklärung für den Namen leitet sich vom mittelfranzösischen Dialektwort „gavaud“ ab, was „gebogenes Bein“ bedeutet. Diese Bezeichnung könnte sich auf einen charakteristischen Schritt der Gavotte beziehen, wie er in Thoinot Arbeaus Orchésographie (1589) erwähnt wird.[2]
Musikalische Form

Kennzeichnend für die Gavotte sind:
- Ein lebhaftes, aber nicht zu rasches Tempo im Alla breve- oder 2/2-Takt. Besonders in Frankreich gibt es auch langsamere Gavotten, z. B. in den Pièces de clavecin von Nicolas Lebègue (1677),[3] Jean-Henri d’Anglebert (1689),[4] oder François Couperin (1713).[5] Das Thema zu Jean-Philippe Rameau berühmter Gavotte mit Variationen (ca. 1727–1728) ist langsam und ungewöhnlich lyrisch, eher eine Aria als ein Tanz. Auch Johann Gottfried Walther in seinem Musicalischen Lexikon (Leipzig 1732) beschreibt die Gavotte als „oft schnell, aber gelegentlich langsam“. Und Johann Joachim Quantz schreibt im Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752), die Gavotte sei ähnlich einem Rigaudon, aber moderater im Tempo. Laut Jean-Jacques Rousseau (1768) ist die Bewegung der Gavotte „...gewöhnlich anmutig und graziös (gracieux), oft fröhlich (gai, allegro), und manchmal auch zärtlich & langsam (tendre & lent)...“.[6]
- Ein hüpfender und fröhlicher, aber auch kultivierter Charakter. Dieser hüpfende, aber noble Charakter ist vermutlich auch ein Unterschied zur etwas rustikaleren und laut Mattheson eher „fliessenden“ und „gemächlichen“ Bourrée.[7][8]
„Das hüpffende Wesen ist ein rechtes Eigenthum dieser Gavotten; keineswegs das laufende...“
- Meist halbtaktiger Auftakt, oft (aber nicht immer) bestehend aus zwei kurz gestoßenen, „hüpfenden“ Vierteln. Dieser kurz gestoßene hüpfende Charakter der Viertel ist typisch und kommt meistens und mindestens in der Begleitung auch während des Stückes immer wieder mal vor. Seltener gibt es auch ganztaktige Gavotten. Der halbtaktige oder ganztaktige Beginn ist noch ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Bourrée, die mit einem einfachen Viertel-Auftakt beginnt.[A 1]
- Die Gavotte verläuft regelmäßig ohne Synkopen; auch dies wieder im Gegensatz zur Bourrée, deren Melodie meistens durch gelegentliche Synkopen aufgelockert wird (oft im letzten Takt einer Halbphrase oder Phrase).
- In der Regel besteht die Gavotte wie die meisten anderen Tänze aus zwei Teilen, die beide wiederholt werden.
- Es gibt auch Gavotten in Rondoform: Die Gavotte en rondeau (normalerweise als A-B-A-C-A). Beispiele findet man schon von Jean-Baptiste Lully, z. B. in den Prologen zu Atys (1676)[A 2] oder zu Armide (1686), und in zahlreichen Werken Rameaus, etwa in seinen Pièces de clavecin von 1706, oder in seinen Opéra-Ballets Les Indes galantes (1735)[10] und Les Fêtes d’Hébé (1739), und der Tragédie Zoroastre (1749).[11] Robert de Visée schrieb eine Gavotte Rondeau für zwei Gitarren mit optionalem zweiten Teil (contrepartie).[12] Aus Deutschland gibt es Beispiele von Georg Philipp Telemann u. a. in der Ouverturensuite La Bizarre TWV 55: G2.[13] Berühmt ist auch die Gavotte en rondeau von Johann Sebastian Bach in seiner Partita Nr. 3 in E-Dur für Solo-Violine, BWV 1006, sowie die Gavotte en Rondeau[14] aus BWV 995. Daneben existieren, erschienen um 1700, auch Tabulaturen von anonymen Komponisten, die in ihren Suiten eine Gavotte en Rondeau aufweisen.[15]
- Eine Gavotte kann auch mit einer zweiten Gavotte gekoppelt werden, die zur ersten kontrastiert, ähnlich wie beim Menuett mit Trio; nach der zweiten Gavotte wird die erste wiederholt. Dieses Phänomen nennt sich Gavotte I & II und ist heute besonders durch die Werke Johann Sebastian Bachs (etwa in der Suite g-Moll BWV 995) und Rameaus bekannt.[16] Besonders bei Rameau kann eine der beiden Gavotten eine Gavotte en rondeau sein (muss aber nicht).[17]
- In (italienischen) Sonaten oder Konzerten kommen gelegentlich Stücke vor, die zwar im Stil der Gavotte geschrieben sind, aber nicht ihre typische Tanzform haben, z. B. von Arcangelo Corelli oder Georg Friedrich Händel. Solche Stücke sind dann bezeichnet mit a tempo di Gavotta (siehe Beispiel).[18]
Geschichte
16. Jahrhundert
Die Gavotte wurde von Thoinot Arbeau in seiner Orchésographie (1589) erwähnt: Er beschreibt sie als Folge (suite) von Branles doubles; dementsprechend verwendet er das Wort „Gavotes“ auch nur im Plural. Sie wurden getanzt in einer Reihe oder im Kreis „...mit kleinen Sprüngen in der Manier des Haut Barrois, mit einem Double nach rechts und einem Double nach links, wie die üblichen Branles…“:[19] Die Gavotte-Branles unterschieden sich von den anderen Branles aber in mindestens zwei Punkten: Galliarde-Schritte wurden in die Double-Sequenzen eingestreut, und jedes Paar tanzte nacheinander allein in der Kreismitte, wonach sie alle anderen Tänzer küssten. Die von Arbeau überlieferte Melodie beginnt nicht mit einem Auftakt, sondern ist ganztaktig.[20]
Tanzformen im 17. und 18. Jahrhundert
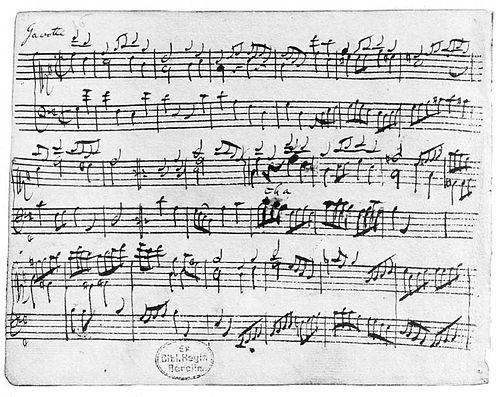
Die Branle-Suite erfuhr im frühen 17. Jahrhundert eine Standardisierung und setzte sich fortan aus fünf verschiedenen Branles zusammen, die stets von einer einzelnen Gavotte abgeschlossen wurden. Diese Kombination erfreute sich großer Beliebtheit an den wichtigen nordeuropäischen Höfen, was durch zahlreiche Sammlungen von Tanzmusik aus dem gesamten Jahrhundert belegt ist. Pierre Rameau berichtet in seinem Werk Le maître à danser (1725), dass diese Branle-Suite während der Regierungszeit Ludwigs XIV. traditionell zur Eröffnung höfischer Festbälle getanzt wurde – zumindest bis in die 1680er Jahre, wobei Rameau hier von einer bereits vergangenen Praxis berichtet[2].
Die Dokumentation der Branle/Gavotte-Choreographien aus dem 17. Jahrhundert ist leider spärlich. Im Manuskript Instruction pour dancer (1612) erfolgt eine kurze Beschreibung einer Gavotteschrittfolge nach einer 6-teiligen Branlesuite[21]. In derselben Quelle ist auch La Gilotte notiert, eine Choreographie für vier Paare, in der diese Gavotteschrittfolge durchgehend verwendet wird[22]. François de Lauze erklärt in seiner Apologie de la danse (1623), dass eine detaillierte Beschreibung der Schritte und Bewegungen aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des Tanzes überflüssig sei. Allerdings erwähnt er die Existenz von mindestens drei verschiedenen Gavotte-Varianten sowie bedeutende regionale Unterschiede. Marin Mersenne liefert in seiner Harmonie universelle (1636) eine Beschreibung, die Arbeaus Darstellung ähnelt, ergänzt aber zusätzliche Details zum Soloteil des Tanzes[2].
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich parallel zur traditionellen Branle/Gavotte ein neuer Gavotte-Typ, der unabhängig von der Branle-Suite existierte. Diese eigenständige Form wurde erstmals in den Bühnenwerken Jean-Baptiste Lullys eingeführt, der zwischen 1653 und 1687 mindestens 37 solcher Gavotten in seine Theater- und Opernwerke integrierte. Diese neuen Gavotten behielten zwar das Zweiermetrum und die viertaktigen Phrasen der ursprünglichen Form bei, wurden aber in binärer Form komponiert, das heißt mit zwei sich wiederholenden Musikabschnitten. Ein charakteristisches Merkmal dieser neuen Gavotten war ihre besondere rhythmische Struktur: Die Melodie setzte in der Mitte des Taktes ein, üblicherweise mit einem langen Auftakt[20].
Etwa 30 Gavotten und gavotte-ähnliche Tänze sind uns in der Beauchamp-Feuillet-Notation überliefert. Wie es typisch für die Tänze des französischen Barockstils war, besaß jede von ihnen ihre individuelle Choreographie: Ein spezifisches Bodenmuster und eine eigene Schrittfolge, die zu einer bestimmten Musikkomposition aufgeführt werden musste. Diese Gavotten lassen sich basierend auf ihrem Schrittvokabular und der Anzahl der teilnehmenden Tänzer in drei verschiedene Kategorien einteilen:
Die erste Kategorie bildete der Theatertanz, der sich durch seine komplexe Schrittfolge auszeichnete. Er wurde üblicherweise als Solo oder Duett aufgeführt, entweder von Männern oder Frauen, und zeichnete sich häufig durch ein deutlich langsameres Tempo aus.
Die zweite Kategorie war die Gesellschaftstanzform der "danse à deux", die ihren Platz bei Hof und anderen festlichen Bällen hatte. Diese Gavotte-Form verfügte zwar über ein reichhaltiges Schrittvokabular, unterschied sich aber von anderen Barocktänzen vor allem durch den häufigen Einsatz des Assemblé. Dieser Schritt diente dazu, kurze und klar strukturierte Tanzphrasen zu bilden. Charakteristisch war dabei die Kombination mit dem Contretemps de Gavotte. Diese Schrittfolge, die sich vereinfacht als "Hopp-Schritt-Schritt-Sprung" beschreiben lässt[3], wurde typischerweise noch durch einen vorbereitenden Schritt im langen Auftakt eingeleitet.
Eine dritte Variante war eine wesentlich einfachere Form für mindestens zwei Tanzpaare. Sie zeichnete sich durch ein reduziertes Repertoire an Schrittkombinationen aus, behielt aber das charakteristische Kadenzmuster bei. Zwei bekannte Beispiele dieser Tanzform sind Le Cotillon aus dem Jahr 1705 und La Gavotte du Roi von 1716, die möglicherweise Elemente der älteren Branle/Gavotte-Tradition bewahrten. Interessanterweise erwähnt Raoul-Auger Feuillet 1706 in seiner Abhandlung Recueil des Contredanses zwar einen Pas de Gavotte, aber weder er noch seine Zeitgenossen lieferten eine genaue Definition dieses Schrittes. Erst in Jossons Traité abbregé de la Danse (1763) findet sich eine Beschreibung, die der bereits erwähnten Schrittkombination entspricht.[2]
Diese Entwicklung führte schließlich zu einer engen Verbindung mit der Contredanse française, einem Tanz für acht Personen in quadratischer Aufstellung. Diese Tanzform ist charakterisiert durch eine "Strophe-Refrain"-artige Abfolge von Tanzfiguren mit einfachen Schrittfolgen aus einem begrenzten Bewegungsrepertoire. Die Contredanse française übernahm dabei wesentliche Elemente der Gavotte, insbesondere den typischen Gavotte-Schritt und ihre rhythmische Struktur. In der Mitte des Jahrhunderts vollzog sich allerdings ein Wandel in der Taktart: Der ursprüngliche alla breve oder C-Takt wurde durch den 2/4-Takt ersetzt, wobei sich die Betonung von halben auf Viertelnoten verlagerte. Die enge Verwandtschaft der Gavotte-Melodien mit der Contredanse française wird durch C. Compan bestätigt, der 1787 schrieb, dass die Contretänze "fast alle Gavotten" seien ("presque toutes des Gavottes"). In dieser Form fand die Gavotte auch Eingang in das Kompositionsrepertoire der Klassik. Der Musikwissenschaftler S. Bennet Reichart konnte 1984 nachweisen, dass Mozart in vielen seiner lebhaften Finalsätze im Zweiertakt die Form der Gavotte en Rondeau aufgriff, wie beispielsweise in seinen Werken KV 239, KV 563 und KV 545.[20]
Die Gavotte behielt ihre Bedeutung als Bühnentanz auch dann noch bei, als sie als Gesellschaftstanz bereits aus der Mode gekommen war. Besonders Jean-Philippe Rameau integrierte sie zwischen 1733 und 1764 häufiger als jede andere Tanzform in seine Bühnenwerke, z. B. für seine Tragédie-lyrique Zoroastre (1749/1756) eine Gavotte tendre (Akt I,3), eine Gavotte en Rondeau I & II (Akt I,3), eine Gavotte gaye (Akt II,3), und für das abschließende Ballett noch eine Première Gavotte vive & Gavotte II (Akt V,8). Auch Gluck und Mozart (z. B. eine Gavotte für die Ballettmusik zu seiner Oper Idomeneo von 1779, KV 367) griffen in ihren Kompositionen auf getanzte Gavotten zurück. Im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts diente die Gavotte als beliebte Zwischenaktunterhaltung und war noch 1817 im Repertoire der Pariser Oper zu finden.[2]
Musikalische Formen im 17. und 18. Jahrhundert
Im Rahmen der Bühne wurde die Gavotte nicht selten auch gesungen, oft von einem Vorsänger oder einer Vorsängerin, und dann vom ganzen Chor wiederholt, oder von einem solistischen Gesangsensemble[23] – das alles in Kombination mit Bühnentanz. Ein Beispiel wäre in Lullys Atys die Gavotte in Akt IV,5, wo Flussgötter, Gottheiten von Quellen und Bächen zusammen tanzen und singen: La Beauté la plus sévère / prend pitié d'un long tourment / et l’Amant qui persévère / devient un heureux Amant... (= „Selbst die gestrengste Schönheit hat Mitleid mit einer langen Qual, und der beständig Liebende wird ein glücklicher Geliebter...“).[24]
Die Gavotte gehörte zu den mit Abstand beliebtesten Instrumentalformen, die auf Tänzen basierten. Sie fand auch als einer der ersten „Zusatztänze“, oder Galanterien, Eingang in die Cembalosuite. Zu den allerersten musikalischen Beispielen überhaupt zählen je eine Gavotte von Jacques Hardel und von Nicolas Lebègue im berühmten Manuscrit Bauyn; da der früh verstorbene Louis Couperin (1626–1661) zu beiden ein Double schrieb, müssen diese Stücke vor 1661 entstanden sein.[25][26] Die Gavotte von Hardel war ein berühmtes Stück, das bis nach 1750 in zahlreichen Manuskripten kopiert wurde, und auch in Versionen für andere Instrumente, als Trink- und als Liebeslied existierte;[27] sie wurde auch manchmal von anderen Komponisten nachgeahmt, z. B. von François Couperin in seinem Premier Ordre (Livre premier, 1713).[28]
In der Cembalomusik seit Lebègue (Livre Premier, 1677), gehörte die Gavotte wie das Menuet zu fast jeder Suite (ebenso wie in Suiten für Laute oder Gitarre[29]). Sie stand in Frankreich normalerweise gegen Ende der Suite, nach der Gigue und manchmal auch nach einer Chaconne, gefolgt nur vom abschließenden Menuet. Beispiele dafür finden sich bei Lebègue (1677, 1687),[30] Élisabeth Jacquet de la Guerre (1687),[31] d’Anglebert (1689),[32] Louis Marchand (1702, 1703),[33] und Rameau (1706).[34] Erst bei François Couperin (Livre premier, 1713) findet sich die Gavotte weiter nach vorne in der Abfolge, da er viele Charakterstücke anhängt, und ab 1716 (Second Livre) verschwinden die meisten Tänze zugunsten der Charakterstücke; aber auch bei ihm gibt es noch die Koppelung von Gavotte-Menuet.[35] Auch Rameaus obenerwähnte Gavotte mit 6 Variationen (ca. 1727–1728) bildet den Abschluss einer größeren Suite (in a / A).
In Deutschland fand die Gavotte durch die Generation der sogenannten Lullisten (Johann Sigismund Kusser, Georg Muffat, Johann Caspar Ferdinand Fischer u. a.) Eingang in ihre Orchester- und Claviersuiten. Komponisten im italienfreundlichen Süden verwendeten dabei oft die italienische Namensform Gavotta, auch wenn die Stücke stilistisch gänzlich französisch sind (Muffat, Aufschnaiter).[36] Die Reihenfolge in der Suite entsprach dabei der lockeren und freien Abfolge, die man auch in Frankreich verwendete, wenn man Tänze und Orchesterstücke aus Opern und Balletten zusammenstellte; in dieser Form wurde sie auch gerne von Telemann, Händel, J. S. Bach und ihren Zeitgenossen verwendet. Bach ordnete die Gavotte in seinen Cembalo- und Solosuiten und Partiten normalerweise zwischen Sarabande und Gigue ein,[A 3] und verwendete in seinen Französischen und Englischen Suiten wie auch andere Komponisten des 18. Jahrhunderts gerne die Kombination von Gavotte I und II (siehe oben).
Gavotte de Vestris

Eine besondere Bedeutung erlangte die Gavotte de Vestris, ein Theaterduett des berühmten Tänzers Gaetano Vestris, dessen Musik von André-Ernest-Modeste Grétry für die Comédie lyrique Panurge dans l’île des lanternes („Panurge auf der Insel der Laternen“) 1785 komponiert wurde.
Die Choreographie, die die Vorstellung von der Gavotte im 19. Jahrhundert wesentlich prägte, stammte von Maximilien Gardel. Obwohl keine direkten Aufzeichnungen oder Beschreibungen der Originalchoreographie überliefert sind, existieren verschiedene Versionen aus dem 19. Jahrhundert, z. B. von Théleur, 1831, oder Zorn, 1887, teils als verbale Beschreibungen, teils als Tanznotationen oder in beiden Formen.
Die musikalische Struktur blieb dabei im Zweiertakt mit vier- und achttaktigen Phrasen erhalten, verlor jedoch das charakteristische rhythmische Muster mit Beginn in der Taktmitte. Die verschiedenen überlieferten Versionen zeigen zwar Gemeinsamkeiten in Schritten und räumlicher Gestaltung, unterscheiden sich aber besonders im Schwierigkeitsgrad so deutlich voneinander. Ende des 19. Jahrhunderts schuf schließlich Giraudet eine vereinfachte Version für zwei Paare, die sowohl in den Schritten als auch in der Beziehung zwischen Tanz und Musik deutliche Modifikationen aufwies[2].
Spätes 19. und 20. Jahrhundert
Komponisten des späten 19. und des 20. Jahrhunderts schrieben gelegentlich „Gavotten“, die wenig oder gar nichts mit dem barocken Tanz zu tun haben, das gilt besonders für die polkaartigen Stücke von Johann Strauss Sohn (Gavotte der Königin, op. 391) und Carl Michael Ziehrer (Goldene Jugendzeit, op. 523); aber auch für Richard Strauss (Suite in B-Dur op. 4). In der Suite populaire brésilienne für Gitarre von Heitor Villa-Lobos heißt der vierte Satz Gavotta-Choro.
Näher am Charakter des barocken oder Rokoko-Originals sind die Gavotte in Edvard Griegs Holberg-Suite op. 40, oder die (gesungene) Gavotte aus Ambroise Thomas’ Oper Mignon. Auch Jules Massenet ließ sich durch Zeit und Handlung seiner Oper Manon zu einigen Takten „Gavotte“ in einer Szene für Koloratursopran inspirieren, die als „Gavotte der Manon“ bekannt ist.
Gavotten gibt es auch bei Gilbert and Sullivan: Im zweiten Akt von The Gondoliers und im Finale von Akt I von Ruddigore. Sergei Prokofiev benutzt eine „Gavotte“ anstelle eines Menuetts in seiner Classical Symphony.
Das sogenannte „Glühwürmchenidyll“ aus der Oper Lysistrata (1902) von Paul Lincke ist auch als Gavotte Pavlova bekannt, weil es ein Lieblingsstück der berühmten Tänzerin Anna Pawlowa war, die dazu eine eigene Choreographie erfand und auf ihren Tourneen tanzte.[37]
Verschiedene Tanzlehrer veröffentlichten auch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als Gavotte bezeichnete Choreographien für den Ballsaal oder als Vorführtanz, so die Quadrille Gavotte der Kaiserin (1893)[38] oder Cupid’s Gavotte (1915)[39]
Gavotte in der bretonischen Musik
In Frankreich werden auch heute verschiedene Volkstänze unter der Bezeichnung Gavotte gepflegt, insbesondere in der Bretagne, wo zahlreiche Gavotten (Gavotte de l’Aven, Dañs Fisel, Gavotte des Montagnes, Kost ar c'hoat) zum festen Bestandteil von Tanzfesten wie dem Fest-noz gehören. Diese traditionellen Tänze zeichnen sich durch eine große Vielfalt an Schritten, Bewegungsmustern und regionalen Aufführungstraditionen aus. Der Rhythmus ist ein zumeist synkopisch gespielter 4/4-Takt, aber es sollen auch 9/8- und 5/8-Takte vorkommen.[3]
Die Gavotte des Montagnes und der Dañs Fisel werden i. d. R. in einer dreiteiligen Suite aufgeführt in der auf einen ersten schnellen Teil (Ton simpl) ein langsamer Schreittanz (Tamm-kreiz) folgt, an den sich wiederum ein schneller Schlussteil (Ton doubl) anschließt. Dieser hat denselben Rhythmus wie der Ton simpl, jedoch ist der zweite Teil der zweiteiligen Melodie hier oft um einige charakteristische Takte verlängert.
Quellen
Literatur
- Thoinot Arbeau: Orchésographie... Jehan des Preyz, Langres 1589 / réedition 1596 (Privileg vom 22. November 1588). = Orchésographie. Reprint der Ausgabe 1588. Olms, Hildesheim 1989, ISBN 3-487-06697-1. Digitalisate: http://imslp.org/wiki/Orchésographie (Arbeau, Thoinot), [1]
- Johann Mattheson: Die Gavotta... (§ 87–89) und Die Bourrée (§ 90–92). In: Der vollkommene Capellmeister. 1739. Hrsg. v. Margarete Reimann. Bärenreiter, Kassel u. a., S. 225–226.
- Jean-Jacques Rousseau. Gavotte. In: Dictionnaire de musique. Paris 1768, S. 230. (Siehe auch auf IMSLP: http://imslp.org/wiki/Dictionnaire_de_musique_(Rousseau%2C_Jean-Jacques)).
- Bruce Gustafson, Vorwort zu: Hardel – The Collected Works (The Art of the keyboard 1). The Broud Trust, New York 1991.
- Meredith Ellis Little: Tempo di gavotta. In: Deane Root (Hrsg.): Grove Music Online.
- Meredith Ellis Little, Matthew Werley: Gavotte. In: Deane Root (Hrsg.): Grove Music Online.(updated & rev.: 3 September 2014).
- Carol Marsh: Gavotte. In: Selma Jeanne Cohen (Hrsg.): International Encyclopedia of Dance (published online 2005).
- Nicoline Winkler: Die "Régence" und ihre "Bals publics" – Pariser Contredanses in ihrem kulturellen Umfeld. In: Uwe Schlottermüller (Hrsg.): "Al Ungaresca – al Espaňol" – Die Vielfalt der europäischen Tanzkultur 1420―1820, Tagungsband des 3. Rothenfelser Tanzsymposiums. fagisis Musik- und Tanzedition, Freiburg i.Br., 2012.
Noten
- Jean-Henry d’Anglebert: Pièces de Clavecin – Édition de 1689. Faksimile. Hrsg. de J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1999.
- Manuscrit Bauyn, …, troisième Partie: Pièces de Clavecin de divers auteurs. Faksimile. Hrsg. Bertrand Porot. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 2006.
- François Couperin: Pièces de Clavecin. 4 Bde. Hrsg. Jos. Gát. Schott, Mainz u. a. 1970–1971.
- Nicolas-Antoine Lebègue, Pièces de Clavecin, Premier Livre, 1677. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1995.
- Nicolas-Antoine Lebègue: Le Second Livre de Clavessin, 1687. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay.
- Élisabeth Jacquet de la Guerre: Les Pièces de Clavecin, Premier Livre, 1687. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1997.
- Louis Marchand, Pièces de Clavecin, Livre Premier (1702) und Livre Second (1703). Gesamtausgabe. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 2003.
- Jean-Philippe Rameau, Pièces de Clavecin (Gesamtausgabe). Hrsg. E. R. Jacobi. Bärenreiter, Kasel u. a. 1972.
Weblinks
- YouTube Film 1: Gavotte du Roy (Barocktanz)
- YouTube-Film 2: Gavotte de Vestris, mit Jean-Marie Belmont
- YouTube-Film 3: Gavotte de Dansomanie nach Michel de St. Léon, 1830
- YouTube-Film 4: Gavotte de l’Aven (bretonischer Volkstanz)
Anmerkungen
- ↑ Sehr selten sind Gavotten mit einem einfachen Viertel als Auftakt, dann beginnen allerdings die Grenzen zu verschwimmen, wenn der Interpret nicht versucht, den hüpfenden 'preziösen' Charakter zu betonen.
- ↑ Dieses Stück ist auch als Air pour la suite de Flore (= „Air für das Gefolge der Flora“) bezeichnet (Siehe außerdem den YouTube-Film 2 unter den Weblinks).
- ↑ Es muss betont werden, dass diese Ordnung nur typisch für Bach ist und nicht verallgemeinert werden kann (siehe oben).
Einzelnachweise
- ↑ Johann Mattheson, „Die Gavotta...“ (§ 87-89), in: Der vollkommene Capellmeister. Bärenreiter, Kassel u. a. S. 225.
- ↑ a b c d e f Carol Marsh: Gavotte. In: International Encyclopedia of Dance. Online Version. Oxford University Press, 2005, doi:10.1093/acref/9780195173697.001.0001.
- ↑ a b c Meredith Ellis Little: Gavotte. In: Grove Music online. Oxford University Press, 2001, doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.10774.
- ↑ D’Anglebert war ein Mitarbeiter Lullys, in dessen Comédie-ballets und Tragédies er Continuo spielte; d’Anglebert schreibt bei mehreren seiner Gavotten für Cembalo ausdrücklich die Vortragsbezeichnung lentement („langsam“). Zwei von diesen Stücken sind alte Weisen (Airs anciens), die er für Cembalo gesetzt und mit seinen blumigen Verzierungen versehen hat; zumindest eine dieser alten Weisen (Ou estes-vous allé?) ist aber vermutlich keine alte Gavotte, sondern ein altes Volkslied. S. Jean-Henry d’Anglebert: Pièces de Clavecin – Édition de 1689. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1999, S. 23 (G), S. 55–56.
- ↑ Bei F. Couperin z. B. die ansonsten sehr typische Gavotte in g-moll des Second Ordre. ( François Couperin: Pièces de Clavecin. Schott, Mainz 1970–1971, Bd. 1, S. 15.)
- ↑ ...Le mouvement de la ‚Gavotte‘ est ordinairement gracieux, souvent gai, quelquefois aussi tendre & lent. Siehe: Jean-Jacques Rousseau: Gavotte. In: Dictionnaire de musique. Paris 1768, S. 230. Siehe auch auf IMSLP: http://imslp.org/wiki/Dictionnaire_de_musique_(Rousseau%2C_Jean-Jacques), gesehen am 12. August 2017.
- ↑ Die Bourrée belegt Mattheson u. a. mit den Eigenschaften: „...etwas gefülltes, gestopftes, wolgesetztes, starckes, wichtiges, und doch weiches oder zartes das geschickter zum schieben, glitschen oder gleiten ist, als zum heben, hüpffen oder springen“. Einen Paragraphen weiter sagt er über eine bestimmte Bourrée namens la Mariée („die Braut“): „Er schickt sich wahrlich zu keiner Art der Leibesgestalten besser als zu einer untergesetzten.“. Siehe: Johann Mattheson: Die Bourrée. (§ 90–92) In: Der vollkommene Capellmeister. Bärenreiter, Kassel u. a. S. 225–226.
- ↑ Auch Louis de Cahusac schrieb in der Encyclopédie von 1751 (Bd. 2, S. 372), man habe die Bourrée „… wenig verwendet, weil dieser Tanz nicht edel genug schien für das Théatre de l’Opéra.“
- ↑ Johann Mattheson: Die Gavotta.... In: Der vollkommene Capellmeister. Bärenreiter, Kassel u. a. § 88, S. 225. (Mattheson bezieht sich hier mit dem Begriff „lauffenden“ auf italienische Geiger, die offenbar die Gavotte missinterpretierten, und viele Läufe einfügten.)
- ↑ Les Indes galantes, 3. Aufzug (3me Entrée).
- ↑ Zoroastre, Akt 1, Szene 3.
- ↑ Frederick Noad: The Baroque Guitar (= The Frederick Noad Guitar Anthology. Band 2). Ariel Publications, New York 1974; Neudruck (mit CD): Amsco Publications, New York / Sydney, ISBN 978-0-8256-1811-6, S. 34–35.
- ↑ und auch in der Suite TWV 55: D18.
- ↑ Vgl. etwa Frederick Noad: The Baroque Guitar (= The Frederick Noad Guitar Anthology. Band 2). Ariel Publications, New York 1974; Neudruck (mit CD): Amsco Publications, New York / Sydney, ISBN 978-0-8256-1811-6, S. 74–75 (auch in Pieces pour la Luth a Monsieur Schouster, par J. S. Bach).
- ↑ Vgl. etwa Adalbert Quadt: Gitarrenmusik des 16.–18. Jahrhunderts. Nach Tabulaturen hrsg. von Adalbert Quadt. Band 1–4. Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1970 ff., Band 2: nach Tabulaturen für Colascione, Mandora und Angelica, 3. Auflage ebenda 1972, S. 23, 38 und 40–43.
- ↑ Von Rameau gibt es Beispiele u. a. in Les Indes galantes (1735), Zoroastre (1749/1756), Daphnis et Aeglé (1753), Les Boreades.
- ↑ Ein Beispiel ist in Les Indes galantes, 2me Entrée, wo die Gavotte 2 ein Rondeau ist.
- ↑ Siehe auch: Meredith Ellis Little: Tempo di gavotta. In: Deane Root (Hrsg.): Grove Music Online.(zuletzt eingesehen: 3. Januar 2016).
- ↑ Gavottes, cest un recueil & ramazun de plusieurs branles doubles que les joueurs ont choisy entre aultres, & en ont composé une suytte que vous pourrez sçavoir deulx & de voz compagnons, a laquelle suytte ils ont donné ce nom de Gavottes, lesquelles se dancent par mesure binaire, avec petits saults, en façon de hault barrois, … (unterstrichene Textstelle entspricht dem kurzen Zitat im Haupttext). Siehe: Thoinot Arbeau: Orchésographie... Jehan des Preyz, Langres 1589 / réedition 1596 (Privileg vom 22. November 1588). = Orchésographie. Reprint der Ausgabe 1588. Olms, Hildesheim 1989, ISBN 3-487-06697-1.
- ↑ a b c Carol Marsh, Stehanie Schroedter: Gavotte. In: Laurenz Lütteken (Hrsg.): MGG Online. New York / Kassel / Stuttgart 2016 (bsb-muenchen.de).
- ↑ Angene Feves, Ann Lizbeth Langston, Eugenia Roucher, Uwe Schlottermüller (Hrsg.): Instruction pour dancer. An anonymous manuscript. fagisis Musik- und Tanzedition, Freiburg i. Br. 2000, S. 50 f.
- ↑ Nicoline Winkler: La Gillotte, eine "Gavotte à figures". In: Uwe Schlottermüller (Hrsg.): Morgenröte des Barock. Tagungsband des Symposiums für Historischen Tanz, Burg Rothenfels am Main, 2004. fagisis Musik- und Tanzedition, Freiburg i. Br. 2004, S. 245 ff.
- ↑ Siehe auch: Johann Mattheson: Die Gavotta... (§ 87–89.) In: Der vollkommene Capellmeister. Bärenreiter, Kassel u. a. S. 225.
- ↑ Im Libretto findet sich der Eintrag chantants, & dansants ensemble („zusammen singend und tanzend“). Siehe: Philippe Quinault: Libretto zu Lullys Atys. Im Begleitheft zur CD-Einspielung: Atys, de M. de Lully. Les Arts florissants, William Christie. Harmonia Mundi France, 1987, S. 144–145.
- ↑ Manuscrit Bauyn, …, troisième Partie: Pièces de Clavecin de divers auteurs. Faksimile. Hrsg. Bertrand Porot. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 2006, S. 75–76 (Hardel-L. Couperin) und S. 79 (Lebègue-L. Couperin).
- ↑ Louis Couperins Double zu Lebègue steht merkwürdigerweise in einem ganz anderen Taktschema als das Originalstück (Phrasen von je 7 Takten bei Couperin, statt je 4 Takte bei Lebègue). Lebègue veröffentlichte 1677 die gleiche Gavotte in C mit einem eigenen Double. Siehe: Nicolas-Antoine Lebègue: Pièces de Clavecin, Premier Livre, 1677. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1995, S. 77–78.
- ↑ Bruce Gustafson, Vorwort zu: Hardel – The Collected Works (The Art of the keyboard 1). The Broud Trust, New York 1991, S. xii, auch S. 36–38.
- ↑ Bei Couperin ist vor allem die aufsteigende punktierte Linie am Anfang sofort zu erkennen, auch wenn das Stück in g-moll steht. François Couperin: Pièces de Clavecin. Schott, Mainz 1970–1971, Bd. 1, S. 15–16. Eine weitere „Kopie“ schrieb auch Lebègue, in der gleichen Tonart wie Hardel (a-moll). Nicolas-Antoine Lebègue: Pièces de Clavecin, Second Livre. 1687. D’Anglebert spielt zu Beginn seiner Gavotte in G (1689) mit einer Umkehrung der Hardel-Melodie. Jean-Henry d’Anglebert: Pièces de Clavecin – Édition de 1689. Faksimile. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1999, S. 23.
- ↑ Vgl. etwa Camille de Tallard, bearbeitet etwa bei Hubert Zanoskar (Hrsg.): Gitarrenspiel alter Meister. Original-Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Band 1. B. Schott’s Söhne, Mainz 1955 (= Edition Schott. Band 4620), S. 19—20; und Frederick Noad: The Baroque Guitar (= The Frederick Noad Guitar Anthology. Band 2). Ariel Publications, New York 1974; Neudruck (mit CD): Amsco Publications, New York / Sydney, ISBN 978-0-8256-1811-6, S. 48–49 mit Anmerkungen zu einer Gavotte von Ludovico Roncalli).
- ↑ 1677: Gavotte-Menuet am Ende: Suiten in g-moll und C-Dur. Gavotte am Ende (kein Menuet): Suiten in D und in F. Die Suite in d-moll hat nach Gavotte und Menuet am Ende noch eine Canaris. (Ohne Gavotte: Suite in a). 1687: Gavotte-Menuet am Ende: Suite in a-moll. Gavotte I & II am Ende: Suite in g-moll. Gavotte-Petitte Chaconne am Ende: Suite in G-Dur (Ohne Gavotte: Suiten in A und F). Siehe: Nicolas-Antoine Lebègue: Pièces de Clavecin, Premier Livre, 1677. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1995. Und: Nicolas-Antoine Lebègue: Le Second Livre de Clavessin, 1687. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay.
- ↑ In der Suite in a-moll (die anderen drei Suiten sind ohne Gavotte). Élisabeth Jacquet de la Guerre: Les Pièces de Clavecin, Premier Livre. 1687. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1997, S. 40–58 (Gavotte-Menuet auf S. 57–58).
- ↑ Die Suiten in G und d schließen mit Gavotte-Menuet (es folgt jeweils eine Ouverture von Lully, die man logischerweise als Beginn für eine andere Folge von Sätzen ansehen kann), in g-moll gibt es zwischen Passacaille und der Ouverture von Lully keine Originalkompositionen mehr, aber vier Stücke, von denen das erste ein Menuet von Lully ist, dann zwei Airs anciens, die er als Gavotten deklariert, und zum Abschluss ein Vaudeville im Menuet-Charakter. Die Suite in D-Dur hat keins von beiden. Jean-Henry d’Anglebert: Pièces de Clavecin – Édition de 1689. Faksimile. Hrsg. J. Saint-Arroman. Édition J. M. Fuzeau, Courlay 1999, S. 23–24 (G-Dur), S. 83–84 (d-moll).
- ↑ Die beiden Bücher stellen jeweils eine Suite vor, die beide mit Gavotte-Menuet enden, im Fall von 1703 sind es Menuet I und II. Louis Marchand: Pièces de Clavecin, Livre Premier (1702) und Livre Second (1703). Édition J. M. Fuzeau, Courlay 2003.
- ↑ Jean-Philippe Rameau: Pièces de Clavecin. (Gesamtausgabe) hrsg. von E. R. Jacobi. Bärenreiter, Kassel u. a. 1972, S. 1–13 (Gavotte auf 12–13).
- ↑ Im 2me und 3me Ordre. François Couperin: Pièces de Clavecin, Bd. 1. Hrsg. Jos. Gát. Schott, Mainz u. a. 1970–1971, S. 45f und S. 82f.
- ↑ Muffat im Armonico Tributo (1682) und in Exquisitoris Harmoniae Instrumentalis Gravi-Iucundae Selestus Primus (1701), und Aufschnaiter in den Serenaden seiner Sammlung Concors discordia, Nürnberg 1695.
- ↑ Begleittext zur CD-Sammlung (Übers. v. Gery Bramall): Fête du Ballet – A Compendium of Ballet Rarities. (10 CDs; hier CD Nr. 2 Homage to Pavlova). Dir. Richard Bonynge, verschiedene Orchester. Decca, 2001, S. 29.
- ↑ Peter Ludwig Hertel: Gavotte der Kaiserin. Theaterverlag Eduard Bloch, Berlin 1894.
- ↑ Susan de Guardiola: Cupid's Gavotte. In: Capering & Kickery. 4. Februar 2021, abgerufen am 13. April 2025.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Illustration in music notation of basic original rhythm of the gavotte. Musical notation, input, and screen-capture by [1].
Louis Marchand, Pièces de Clavecin, Second Livre, Paris 1703 (complete)
Gavotte from first notebook for Anna Magdalena Bach (French suite No.5, G major, BWV 816)
Taken from the Bach Gesamtausgabe (BGA), vol. 44 [B.W. XLIV]: "Joh. Seb. Bach's handschrift" (Joh.Seb.Bach's manuscripts), Originally published by the Bach-Gesellschaft in Leipzig, 1895. This image is in the public domain.(c) Mussklprozz, CC BY-SA 3.0
Auszug aus Georg Friedrich Händel, Sonata Op. 1 No. 7, 4. Satz: A Tempo di Gavotti
Gavotte de Vestris