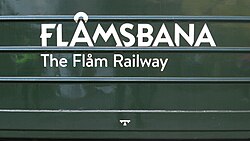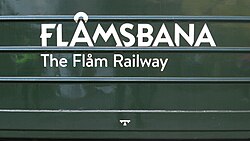Flåmsbana
| Flåm–Myrdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(c) S.Wetzel, CC BY-SA 4.0 Signet der Flåmsbana auf einer E-Lok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | Flåm–Myrdal: R 45[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 20,20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | 15 kV, 16,7 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | 55 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | 130 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | 40 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Flåmsbana (deutsch: „die Flåmbahn“) ist eine normalspurige Eisenbahnstrecke in Norwegen, die in der Provinz Vestland die Orte Myrdal und Flåm in der Gemeinde Aurland miteinander verbindet. Sie zweigt von der Hauptstrecke der Bergenbahn ab, verläuft in nördlicher Richtung durch das Flåmsdalen und endet am Aurlandsfjord, einem Seitenarm des Sognefjords. Auf einer Länge von 20,2 km wird ein Höhenunterschied von 865 m überwunden, wobei die maximale Neigung 55 Promille beträgt. Aufgrund ihrer Steilheit und der malerischen Landschaft ist die Flåmbahn heute fast ausschließlich eine Touristenattraktion und hat sich zu einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Norwegens entwickelt.
Der Bau der Strecke begann 1924, ihre Eröffnung erfolgte 1940. Sie ermöglichte die Anbindung des Aurlandsfjords im damaligen Distrikt Sogn an die von Bergen nach Oslo führende Bergenbahn. Die elektrische Traktion besteht seit 1944. Der Güterverkehr wurde 1992 eingestellt. Aufgrund der niedrigen Fahrpreise und hohen Betriebskosten stand die Strecke kurz vor der Stilllegung. 1998 übernahm die Gesellschaft Flåm Utvikling das Marketing und den Fahrkartenverkauf für die Strecke; die Preise wurden markant erhöht und neue Lokomotiven eingesetzt. Die Züge werden weiterhin von der Staatsbahn Vy als Subunternehmer für Flåm Utvikling betrieben, während die Strecke selbst seit 2017 im Besitz des Infrastrukturunternehmens Bane NOR ist.
Strecke
Allgemeines

Die Flåmbahn verläuft von Myrdal an der Bergenbahn nach Flåm. Der Bahnhof Myrdal liegt an einem Gebirgspass auf 867 moh. (= meter over havet), der Bahnhof Flåm auf 2 moh. Die maximale Neigung der Strecke beträgt 55 Promille, wovon 16,0 km eine Neigung von mindestens 28 Promille aufweisen. Die Strecke ist in Normalspur (1435 mm) ausgeführt und besitzt einen Mindestkurvenradius von 130 m,[2] womit sie eine der steilsten Normalspurbahnen Europas ist.[3] Bergauf beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h und bergab 30 km/h. Um lawinengefährdete Bereiche im Flåmsdalen zu umgehen, führt die Strecke durch 20 Tunnel und kreuzt den Fluss Flåmselvi mehrfach. Jedoch wurde hierfür nur an einer Stelle eine Brücke gebaut, für die übrigen Querungen wird der Flåmselvi in Verrohrungen unter der Strecke hindurchgeleitet.[2] Außer den beiden Endbahnhöfen bedient die eingleisige Strecke auch neun Zwischenhaltestellen. Sie ist mit 15 kV 16,7 Hz Wechselspannung über Oberleitungen elektrifiziert und seit 2005 mit GSM-R ausgestattet[4], verfügt jedoch nicht über ein zentralisiertes Betriebsleitsystem.[5]
Streckenverlauf
Ausgangspunkt der Flåmbahn ist der Bahnhof Myrdal, ein Inselbahnhof mit breitem Mittelbahnsteig. Während die Züge der Bergenbahn an dessen Ostseite halten, fahren die Züge der Flåmbahn von der Westseite ab; in Richtung Bergen besteht eine Gleisverbindung. In nördlicher Richtung verläuft die Strecke zunächst rund einen halben Kilometer parallel zur Bergenbahn in Richtung Oslo, ehe sie ins Flåmsdalen hinabsteigt. Durch mehrere Schutzgalerien und kurze Tunnel hindurch[6] erreicht sie die Haltestelle Vatnahalsen (811 moh.) beim gleichnamigen Hotel.[7] Über eine nach Osten gerichtete Kehrschleife geht es weiter nach Reinunga (767 moh.) und zum Vatnahalsen-Tunnel. Dieser 889 m lange Kehrtunnel unterquert das Hotel und weist ebenfalls eine Schleifenform auf; er bringt die Strecke zunächst in eine südwestliche und anschließend in eine nordöstliche Richtung. Er mündet auf einem künstlichen Felsvorsprung, der mehrere hundert Meter in die Tiefe abfällt.[8] Unmittelbar nach dem Bakli-Tunnel folgt die Haltestelle Kjosfossen (670 moh.), die einzig dem Zweck dient, Touristen die Aussicht auf den Wasserfall Kjosfossen zu ermöglichen.[9]

Hoch über der Schlucht des Flåmselvi wendet sich die Strecke im Kjosfoss-Tunnel (478 m) nach Westen und anschließend im Nåli-Tunnel, mit 1342 m der längste der Flåmbahn, nach Nordwesten.[10] Am Ende dieses Tunnels liegt die frühere Haltestelle Kårdal (557 moh.), die einst den am weitesten oben im Flåmsdalen gelegenen Bauernhof bediente.[8] Von hier aus verläuft die Strecke wieder überwiegend in nördlicher Richtung. Auf der gegenüberliegenden Talseite liegt der 1517 m hohe Berg Trollanuten, an dessen Osthang sich jeden Winter mehrere Lawinenabgänge ereignen. Auf den 1029 m langen Blomheller-Tunnel folgt die Haltestelle Blomheller (458 moh.). Die Strecke wechselt danach von der Ost- auf die Westseite des Tals und führt durch eine Reihe kurzer Sporntunnel.[8] Der ungefähr bei Streckenhälfte liegende Bahnhof Berekvam (344 moh.) ist der einzige der Flåmbahn mit einer Ausweiche und somit die einzige Stelle, an der sich Züge kreuzen können. Da der Bahnhof unbemannt und kein Betriebsleitsystem vorhanden ist, wird der Kreuzungsvorgang tagsüber mit Flaggen und in der Dunkelheit mit Fackeln abgewickelt, die vom Personal aus Myrdal oder Flåm aufgestellt werden.[7]
Bei Høga überquert die Bahn erneut den Fluss und wechselt zurück auf die Ostseite. Nach Dalsbotn (199 moh.) folgen die beiden letzten Tunnel der Strecke. Kurz vor dem 424 m langen Furuberget-Tunnel führt die Strecke am Wasserfall Rjoandefossen vorbei, der mit einer Fallhöhe von 140 Metern eine der Hauptattraktionen entlang der Flåmbahn ist. Nach Håreina (41 moh.) verändert das Tal seinen Charakter; es wird breiter, flacher und weist mehr Vegetation auf.[11] Die Haltestelle Lunden (16 moh.) erschließt die erste größere Siedlung im Flåmsdalen. Unter der Europastraße 16 hindurch erreicht die Strecke schließlich den Endbahnhof Flåm (2 moh.). Dieser befindet sich unmittelbar am Ende des Aurlandsfjords, einem Seitenarm des Sognefjords.[7] Flåm selbst zählt rund 400 Einwohner und ist mit einem Hotel sowie einem Kreuzfahrthafen stark touristisch geprägt.[12]
Bahnhöfe und Haltestellen



| Name | Koordinaten | Höhe | Eröffnung | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Myrdal | Koord. | 867 moh. | 10. Juni 1908 (Bergenbahn) / 1. August 1940 |  |
| Vatnahalsen | Koord. | 811 moh. | 1. August 1940 |  |
| Reinunga | Koord. | 767 moh. | 1942 |  |
| Kjosfossen | Koord. | 670 moh. | 1951 |  |
| Kårdal | Koord. | 557 moh. | 16. Juni 1946 (2012 geschlossen) | |
| Blomheller | Koord. | 458 moh. | 1942 |  |
| Berekvam | Koord. | 344 moh. | 1. August 1940 |  |
| Dalsbotn | Koord. | 199 moh. | 1942 (2012 geschlossen) | |
| Håreina | Koord. | 41 moh. | 10. Februar 1941 | (c) Banja-Frans Mulder, CC BY 3.0 |
| Lunden | Koord. | 16 moh. | 1942 |  |
| Flåm | Koord. | 2 moh. | 1. August 1940 |  |
Tunnel
Die Strecke führt durch 20 Tunnel, wobei der Vatnahalsen-Tunnel als Kehrtunnel ausgeführt wurde, um Höhe zu gewinnen. Die Gesamtlänge der Tunnel beträgt 5.962,4 Meter: Damit liegen 28 % der Strecke im Tunnel. Am längsten ist der Nåli-Tunnel.[13]


| Tunnel der Flåmbahn | ||
|---|---|---|
| Name | Länge (m) | Baujahre |
| Toppen, oberer | 101,4 | 1926–1929 |
| Toppen, unterer | 79,9 | 1925–1926 |
| Vatnahalsen | 888,6 | 1924–1934 |
| Tunnel p.1692 | 14,0 | ? |
| Tunnel p.1668 | 22,7 | ? |
| Bakli | 195,1 | 1924–1934 |
| Kjosfoss | 478,4 | 1924–1935 |
| Nåli | 1341,5 | 1924–1935 |
| Blomheller | 1029,6 | 1924–1935 |
| Melhusgjelet | 11,1 | ? |
| Melhus | 177,5 | ? |
| Reppa | 132,9 | 1926–1928 |
| Sjølskott | 39,2 | 1931–1935 |
| Geithus | 139,2 | 1934–1935 |
| Timberheller | 172,6 | 1932–1933 |
| Høga | 59,2 | 1927–1928 |
| Dalsbotn, oberer | 154,3 | 1925–1928 |
| Dalsbotn, unterer | 206,6 | 1930–1935 |
| Spælemyren | 24,6 | 1929–1930 |
| Furuberget | 424,0 | 1926–1934 |
| Gesamt | 5962,4 | 1924–1935 |
Geschichte
Streckenplanungen

Die Pläne zum Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Oslo und Bergen, den beiden größten Städten Norwegens, gehen auf den Forstbeamten Andreas Tanberg Gløersen zurück. 1871 schlug er vor, die Strecke über Hallingdal und Voss zu führen sowie zwei kurze Stichstrecken zu errichten, die die beiden großen Fjordsysteme der Region, den Sognefjord und den Hardangerfjord, miteinander verbinden sollten. Die schmalspurige Alte Vossbahn von Bergen nach Voss wurde 1883 eröffnet, 1908 folgte die normalspurige Bergenbahn zwischen Voss und Hønefoss.[14] Während des Baus der Bergenbahn bauten die Norwegischen Staatsbahnen (NSB) den durch das Flåmsdalen führenden Pfad aus, um den Zugang zum Gebiet um Myrdal zu ermöglichen.[15] Diese Straße wurde zunächst von Pferdekutschen und später von Autos befahren. Sie entwickelte sich zu einer wichtigen Zufahrtsstraße für die Region, war jedoch für schwere Fahrzeuge zu steil und zu schmal. Die Hardangerbahn, die den Hardangerfjord an die Bergenbahn anbindet, wurde 1935 eröffnet und war die erste Eisenbahnstrecke des Fylke, die von Anfang elektrifiziert war.[16]
Erste Vermessungsarbeiten für die Flåmbahn fanden 1893 statt. Das Ergebnis war der Vorschlag für eine kapspurige Schmalspurbahn (1067 mm) mit einer Länge von 18,0 km. Der größte Teil der Strecke sollte als Adhäsionsbahn mit einer Neigung von 25 Promille gebaut werden, ein Teil jedoch als Zahnradbahn mit einer Neigung von 100 Promille. Die Kosten wurden damals auf 3,3 Millionen norwegische Kronen geschätzt.[17] Im Jahr 1904 lag ein Vorschlag für eine komplett andere Strecke zum Sognefjord vor, eine 47,13 Kilometer lange Adhäsionsbahn von Voss über Stalheim nach Gudvangen. Die Kostenschätzung betrug 3,5 Mio. Kronen, doch lokale Politiker hielten diese Variante für schlechter als die Alternative über Flåm. Eine dritte Variante war eine Kombination aus Straßenbahn und Standseilbahn, die zwischen Myrdal und Fretheim gebaut werden sollte. Hier hätten die Kosten lediglich 800.000 Kronen betragen, doch die NSB befürchteten, dass die leichteren Schienenfahrzeuge des Vorschlags nicht ausreichend sein würden, um im Winter durch den Schnee zu fahren.[18] Das geschätzte Verkehrsaufkommen für die Flåmbahn betrug 22.000 Passagiere pro Jahr.[19]
Da die beiden anderen Alternativen verworfen wurden, gewann die Flåm-Alternative allmählich an Zustimmung, und der Eisenbahnausschuss für das Nordre Bergenhus amt empfahl diesen Vorschlag.[18] Die NSB kritisierten die Kombination aus Zahnradbahn und Adhäsionsbahn, weshalb sie eine durchgehende Adhäsionsbahn vorschlugen. Der Eisenbahningenieur Ferdinand Bjerke reiste nach Kontinentaleuropa, um verschiedene Eisenbahnen zu untersuchen. In einem 1911 veröffentlichten vorläufigen Bericht empfahl er eine Adhäsionsbahn, obwohl er auch die Notwendigkeit einer detaillierten Studie über eine Zahnradbahn sah. Bjerkes Abschlussbericht lag 1913 vor. Darin empfahl er zwar die Adhäsion, wies aber darauf hin, dass die Kapazität der Strecke geringer als vorhergesagt und die Kosten mit 5,5 Mio. Kronen dreimal so hoch sein würden. 1915 genehmigten das Arbeitsministerium und der NSB-Vorstand die Pläne.[20]
Politische Auseinandersetzungen
1916 gab auch das Storting seine Zustimmung, doch die Parlamentarier trafen die Entscheidung über die technischen Spezifikationen erst 1923, als sie die Elektrifizierung der Strecke beschlossen.[21] Die Kosten wurden damals auf 14,5 Mio. Kronen geschätzt – der Anstieg war auf die Inflation während des Ersten Weltkriegs zurückzuführen –, wovon 1,2 Mio. von den lokalen Gebietskörperschaften zu tragen waren. Auf der Strecke sollten Gleise mit einem Metergewicht von 25 kg verlegt werden. Der Mindestkurvenradius wurde auf 150 m festgelegt, wobei ausnahmsweise auch 125 m zulässig sein sollten. Die maximal zulässige Neigung sollte 55 Promille betragen.[22]
1915 gab es erstmals den Vorschlag, Busse als Alternative zur Eisenbahn einzusetzen. Dies stieß auf Ablehnung, da Busse nicht den Komfort und die Zuverlässigkeit einer Bahn bieten konnten. 1922 brachte der Direktor der Straßenverkehrsbehörde Statens vegvesen den Vorschlag erneut zur Sprache. Zu den stärksten Gegnern der Busalternative gehörte Ingolf Elster Christensen, Regierungspräsident des Fylke Sogn og Fjordane (wie das Nordre Bergenhus amt seit 1919 hieß) und späterer Parlamentsabgeordneter. Er erklärte, dass seine Provinz einen Teil der regionalen Finanzierung der Bergenbahn unter der Bedingung übernommen hatte, dass eine Nebenstrecke zum Sognefjord gebaut werden würde.[22]
In den 1920er Jahren kam es zu hoher Inflation und hohen Defiziten der öffentlichen Hand. Es bildeten sich mehrere öffentliche Ausschüsse ausschließlich zum Zweck der Kostensenkung. Einer dieser Vorschläge war der Bau einer Straße nach Flåm, der von Hans Kristian Seip, dem Direktor der Straßenverwaltung von Bergen, vorangetrieben wurde.[23] Im Jahr 1925, nach der Ernennung von Johan Ludwig Mowinckels erstem Kabinett, wurde vorgeschlagen, die Eisenbahnstrecke zunächst als Straße auszuführen und die Gleise später zu verlegen. Ein NSB-Vorstandsmitglied schlug eine Hängebahn vor. Da die Eisenbahnvariante im Parlament über eine Mehrheit verfügte, fielen Pläne zur Streichung der Bahnstrecke unter den Tisch. Ein Teil der politischen Unterstützung war darauf zurückzuführen, dass Einigkeit über einen nationalen Eisenbahnplan bestand und die Streichung von Teilen davon den geographischen Kompromiss schaden würde.[22] Das Parlament stimmte jedoch dafür, die Anzahl der Zwischenbahnhöfe auf einen zu reduzieren, wodurch sich die Züge nur in Berekvam kreuzen würden. Der Straßenbau hätte eine Kosteneinsparung von rund 30 Prozent ermöglicht; das Parlament beriet die Straße 1927 ein weiteres Mal, lehnte sie aber erneut ab.[24]
Bauarbeiten


Die Verwaltungsstelle für den Bau wurde 1923 eingerichtet und befand sich bis 1935 in Voss. Bauleiter während dieser Zeit war Peter Bernhard Kristian Lahlum, der auch für die Hardangerbahn verantwortlich war.[23] Nach Fertigstellung der Hardangerbahn ging Lahlum in den Ruhestand, und das Büro wurde nach Flåm verlegt, wo Adolph M. B. Kielland die Leitung übernahm.[25] Anfangs arbeiteten 120 Männer auf den Baustellen, doch diese Zahl stieg schnell auf 220. Später schwankten die Zahlen zwischen diesem Wert und einem Tiefststand von 80, ehe sie 1937 mit 280 Personen ihren Höchststand erreichten. Zur Unterbringung der Bauarbeiter standen acht Baracken zur Verfügung.[26] Zu den ersten Bauwerken gehörten Wohnhäuser und Bahnhofsgebäude, die dann von den am Bau beteiligten Arbeitern genutzt werden konnten.[27] Landwirte aus der Umgebung führten gegen Bezahlung Transporte durch, was die lokale Wirtschaft ankurbelte. Mit Pferden transportierten sie tagsüber Touristen und nachts Baumaterialien. Der Wettbewerb war hart, was zu Auseinandersetzungen um Kundschaft führte. Nach der Stationierung von Verkehrspolizisten beruhigte sich die Lage wieder.[28]
1924 kam es in Høga zu einem Erdrutsch, der das für die Eisenbahn vorgesehene Gebiet verschüttete. Es bestand aus Phyllit und war der geologisch instabilste Abschnitt der Strecke. Die erste Reaktion war, einen Tunnel durch das Gebiet zu planen, was aufgrund der hohen Kosten rasch verworfen wurde. Stattdessen wurden die Gleise weiter vom Berghang entfernt verlegt. Ein weiterer Erdrutsch ereignete sich am 10. Februar 1925 in der Nähe von Store Reppa, wo eine bis zu 3,5 m hohe Schicht abgelagert wurde. Ein weiterer Erdrutsch im April 1925 lagerte oberhalb von Berekvam 1000 Kubikmeter Geröll ab. Eine Lawine am 8. Februar 1928 verursachte einige Schäden an der Trasse in der Nähe von Nåli.[29]
Die Tunnel waren der schwierigste und zeitaufwendigste Teil des Baus. Von den zwanzig Tunneln gelangten nur für die Tunnel Nåli und Vatnahalsen Maschinen zum Einsatz – die übrigen wurden von Hand vorgetrieben. Der Handvortrieb durch den Fels erfolgte durch das Bohren von bis zu 4,2 m langen Löchern, die anschließend mit Dynamit gefüllt und gesprengt wurden. Der Tunnelbau begann 1924; der erste Tunnel konnte 1926 fertiggestellt werden, der letzte Tunnel 1935. Im Durchschnitt mussten pro Meter zwischen 116 und 180 Arbeitsstunden für den Tunnelbau aufgewendet werden.[10] Die Arbeit führte durch Silikose, verursacht durch das Einatmen des Rauchs, zum Tod oder zu lebenslangen Atemwegsproblemen. Es gab zwei tödliche Unfälle, einen im Jahr 1925 und einen im Jahr 1938, die beide mit Tunnelarbeiten in Zusammenhang standen.[30]
Für die Strecke wurden zehn Bahnhöfe und Haltestellen errichtet, hinzu kam eine umfassende Modernisierung des Bahnhofs Myrdal und der Hafenanlagen in Flåm. Der Bahnhof Myrdal wurde mit Nebengleisen und zusätzlichen Gebäuden für umsteigende Fahrgäste ausgestattet, wobei die Modernisierungskosten 0,5 Mio. Kronen betrugen.[31] Berekvam erhielt als einziger Ort eine Ausweiche. Der Bahnhof Flåm kostete 0,8 Mio. Kronen und wurde in den 1930er Jahren im einfachen funktionalistischen Holzstil der NSB entworfen, ähnlich wie die Bahnhöfe an der Nordlandbahn und der Sørlandbahn. Die übrigen Haltestellen und der Bahnhof Berekvam erhielten kleine Holzgebäude mit einem Warteraum, jene in Vatnahalsen, Håreina und Dalsbotn mit einem zusätzlichen Raum für die Lagerung von Fracht.[7]

Die Verlegung der Gleise begann 1936 von Myrdal aus, unterstützt durch zwei Dampflokomotiven. Im ersten Jahr war Reinunga erreicht, im zweiten Jahr der Kjosfossen-Tunnel und 1939 der Blomheller-Tunnel.[18] Der erste fahrplanmäßige Zug fuhr im Oktober 1939 dreimal pro Woche zwischen Myrdal und Berekvam. Dieser Dienst wurde jedoch Ende des Monats eingestellt.[32] Aufgrund der deutschen Besetzung Norwegens begannen die Arbeiten 1940 später in der Saison. Die deutschen Besatzungsbehörden waren jedoch an einer Beschleunigung der Arbeiten interessiert, um die Strecke noch im selben Jahr nutzbar zu machen. Sie planten die Fertigstellung der Strecke für 1942.[25] Dazu erhöhten sie die Zahl der Arbeiter von 58 auf 195. Der reguläre Güterverkehr auf der Flåmbahn wurde am 1. August 1940 aufgenommen, allerdings mit einer Achslastbegrenzung von 12 Tonnen. Zu dieser Zeit gab es vier Züge pro Tag, zwei je Richtung.[32]
Der Personenverkehr begann am 10. Februar 1941, ebenfalls mit zwei Zügen täglich je Richtung.[32] Die Fahrzeit betrug 65 Minuten bergab und 80 Minuten bergauf. Das Ministerium legte am 26. Juni 1941 den offiziellen Namen der Strecke fest.[33] Ab 1. Mai 1942 übernahm Rolf Aksnes nach Kielland die Leitung als Chefingenieur.[25] Während des Baus der Bergenbahn im Jahr 1898 war der obere Teil des Kjosfossen mit einem Wasserkraftwerk bebaut worden.[34] Dort entstand ein weiteres Kraftwerk, das am 27. Oktober 1944 in Betrieb ging. Es wurde von Kværner und Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB) errichtet und hatte eine installierte Leistung von 1700 Kilowatt.[35] Die Kosten für das Projekt beliefen sich auf insgesamt 26.651.900 Kronen, wovon 22,0 Mio. auf die Eisenbahn entfielen. In diesem Gesamtbetrag enthalten waren 2,3 Mio. für das Kraftwerk sowie 1,2 Mio. für einen Fähranleger in Flåm. Erdarbeiten schlugen mit 9,1 Mio. zu Buche, Fahrzeuge mit 2,4 Mio., Bahnhöfe mit 1,6 Mio., Gleise mit 1,2 Mio., Schneeschutz mit 1,5 Mio. und die Elektrifizierung mit 675.000 Kronen.[23]
Entwicklung des Bahnbetriebs

Der reguläre Betrieb mit Elektrolokomotiven begann am 25. November 1944. Zu Beginn wurden Triebwagen der Baureihe Cmo type 4 eingesetzt (ab 1956 als NSB Type 64 bezeichnet). Ursprünglich hatten die NSB geplant, Triebwagenzüge einzusetzen, änderten jedoch während des Krieges ihre Pläne und entschieden sich stattdessen für den Einsatz von Lokomotiven und Wagen. Die Züge der Baureihe Cmo type 4 blieben bis Mai 1947 auf der Flåmbahn im Einsatz. Sie verkehrten üblicherweise auf der Hardangerbahn, wurden aber regelmäßig auf der Flåmbahn eingesetzt, wenn das Verkehrsaufkommen am geringsten war.[35]
Im Oktober 1940 bestellten die NSB bei Thune drei Lokomotiven des Typs El 9. Thune lieferte die Fahrzeuge 1942 aus, wobei die elektrischen Komponenten von NEBB und die Transformatoren und Steuerungen von Per Kure stammten.[35] Ein Bombenanschlag auf das Werk von Per Kure durch den norwegischen Widerstand verursachte eine Verzögerung.[36] Die Lokomotiven waren für die Steilstrecken der Flåm- und Hardanger-Bahnen maßgeschneidert und besaßen eine Achslast von 12 Tonnen sowie eine Bo'Bo'-Achsfolge. Die Lokomotiven wogen 48 Tonnen und das maximal zulässige Zuggewicht betrug 85 Tonnen. Wenn die Züge in Kårdal halten sollten, war das Gewicht weiter auf 65 Tonnen begrenzt.[35] Anfangs verkehrten auf der Bergenbahn täglich drei Zugpaare, sodass auf der Flåmbahn nur eine einzige Lokomotive erforderlich war. Ab 1949 wurden zwei Lokomotiven auf der Flåmbahn eingesetzt und ab 1955 alle drei. Strømmens Værksted lieferte fünf Reisezugwagen aus Aluminium. Die Kosten für die drei Lokomotiven und fünf Wagen beliefen sich auf 2,4 Millionen Kronen.[32]

Die Bahnstrecke verzeichnete rasch einen Anstieg des Verkehrsaufkommens mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11 Prozent ab der Eröffnung bis Mitte der 1950er Jahre.[19] Um den Zugang zum Kjosfossen zum ermöglichen, erfolgte 1951 die Eröffnung der gleichnamigen Station.[7] Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Zahl der Fahrgäste bei 115.000 Personen pro Jahr stabilisiert. Ein erheblicher Teil des Verkehrsaufkommens entfiel auf Touristen, darunter auch Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die in Flåm anlegten. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts brachten die NSB das Paket „Norway in a Nutshell“ auf den Markt, das eine Fahrt mit der Flåmbahn beinhaltete. 1958 erhielt der Nachtzug Bergen–Oslo einen Schlafwagen) von und nach Flåm. Er fuhr während der Sommersaison dreimal pro Woche in beide Richtungen und erreichte eine Auslastung von 84 Prozent.[19] Vom selben Jahr an war der Bahnhof Berekvam unbesetzt.[31] Der Verkehr blieb während der gesamten 1960er Jahre stabil, während das Interesse an der Entwicklung der Eisenbahn für Touristen zurückging und lokale Politiker erklärten, dass eine Straße notwendig sei, um Touristen nach Aurland zu locken.[19]
Im Jahr 1969 nahm die Zahl der Fahrgäste um 10 Prozent und im folgenden Jahr um 12 Prozent zu. 1971 und 1972 verzeichnete die Flåmbahn einen Anstieg von je 20 Prozent – letzteres war das erste Jahr, in dem Interrail-Tickets im Angebot waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte die jährliche Fahrgastzahl 175.000 erreicht.[19] 1970 stationierten die NSB einen zusätzlichen Zug in Flåm, wodurch es möglich war, an einem Tag eine Rundreise zwischen Flåm und Bergen zu unternehmen.[37] Von 1975 bis 1982 führten die NSB direkte Züge zwischen Ål und Flåm.[19] 1978 hielten die morgendlichen Expresszüge der Bergenbahn erstmals in Myrdal, wodurch Touristen einen besseren Zugang zur Flåmbahn erhielten. Das Verkehrsaufkommen stieg weiter an, bis es 1980 200.000 erreichte, und pendelte sich dann während des gesamten Jahrzehnts um diesen Wert ein.[38]

Nachdem die Strecke eröffnet worden war, bewältigte sie während des Baus eines Kraftwerks in Årdal viel Güterverkehr. Von Beginn an war die Flåmbahn das schnellste Transportmittel zwischen Sogn und Oslo sowie Bergen. Auch der Großteil der Post wurde über diese Strecke befördert. Ab 1977 setzte die norwegische Post jedoch überwiegend Lkw über Gol ein, nur für die Postsendungen aus Aurland nutzte sie weiterhin die Bahn. Weitere über die Bahnstrecke transportierte Güter waren Milch für die Molkerei in Voss (bis zu deren Einstellung im Jahr 1983) und Obst.[39] Der Stückgutverkehr verzeichnete in den 1960er Jahren einen starken Anstieg, nachdem sich die NSB und der Fährbetreiber Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane darauf geeinigt hatten, Sendungen über Flåm nach Oslo und Bergen zu transportieren. Flåm verzeichnete bis zur Gründung von Linjegods im Jahr 1973 mehrere Ankünfte wöchentlich. Nach einer Umstrukturierung sank die Anzahl der Ankünfte auf eine pro Woche.[40] Das Frachtvolumen ging in den 1980er Jahren weiter zurück; ein Versuch im Jahr 1978, die drei großen Distributoren Linjegods, Firda Billag und Sogn Billag zu zwingen, den Verkehr über die Flåm-Linie zu leiten, schlug fehl.[41]
Evaluation neuer Fahrzeuge

In den 1970er Jahren machten sich die NSB auf die Suche nach einem Ersatz für die El 9. Neue Lokomotiven würden 20 Mio. Kronen kosten, und das Unternehmen hielt es für unrealistisch, derart viel in eine Nebenstrecke zu investieren. Die NSB hatten außerdem ihr Programm „Vekk med dampen“ zur Abschaffung der Dampflokomotiven abgeschlossen und verfügten daher generell über zu wenige Lokomotiven. Wenn ein neuer Lokomotivtyp gebaut werden sollte, musste dieser mehr als nur die Anforderungen der Flåmbahn erfüllen. Die NSB prüften stattdessen, ob eines der älteren Modelle in Frage kam. In den Jahren 1971 und 1973 führten sie Tests mit der El 11 (Baujahre 1951 bis 1964) und der El 13 (Baujahre 1957 bis 1966) durch. Keines der beiden Modelle erwies sich als optimal: die El 11 ermöglichte zwar eine Erhöhung des Zuggewichts auf 100 Tonnen, aber die Lokomotive hatte die Stufen für den Spannungsregler und den Kommutator auf zu hohe Geschwindigkeiten eingestellt. Die El 13 wiederum verfügte über ältere rheostatische Bremsen, die für die Steigung nicht geeignet waren; außerdem waren die Lokomotiven besser für den Fernverkehr geeignet und würden daher für Nebenstrecken nicht priorisiert werden.[42]
1972 wurde die Flåmbahn umgebaut, um eine Achslast von 18 Tonnen zu ermöglichen. Mitte der 1970er Jahre wählten die NSB die El 11 als Ersatz für El 9, aber erst im November 1980 begann der Umbau von El 11.2098 für ihren neuen Einsatz. Zu den Modernisierungen gehörten rheostatische Bremsen neueren Typs und elektromagnetische Bremsen, neue Geschwindigkeitsmesser und Kurvenlichter. Die Lokomotive befuhr die Flåmbahn erstmals im Juni 1982.[42] Ein Jahr später nahmen die NSB nach einem ähnlichen Umbau auch El 11.2092 in Betrieb. Die El 9 blieben bis 1989 in sporadischem Einsatz. Triebzüge der NSB-Baureihe 69 wurden ab dem 10. August 1982 eingesetzt. Diese waren dem Distrikt Bergen für den Einsatz im Bergener Nahverkehr zugewiesen worden und gelangten auch bei den Direktverbindungen zwischen Bergen und Flåm zum Einsatz.[42] Der größte Nachteil dieser Baureihe waren die kleinen Fenster, da die Züge eher für den Nahverkehr als für Sightseeing konzipiert waren.[39]
Wandlung zur Touristenattraktion
1990 wurde in Sogn eine Schnellfährverbindung mit direkter Route nach Bergen eingeführt. 1991 folgte die Eröffnung des Gudvangatunnels, der Flåm eine Straßenverbindung nach Gudvangen verschaffte und die bisherige Fährverbindung überflüssig machte; außerdem wurde die östlich über den Berg geführte Privatstraße der Wasserkraftwerke in eine Nationalstraße (Riksvei Nr. 50) umgewandelt und ausgebaut. Die NSB machten mit der Flåmbahn Verluste, was zum Teil auf die sehr geringen Einnahmen pro Fahrgast zurückzuführen war. Es galten die gleichen Tarife wie anderswo, basierend auf einer Gebühr pro Kilometer; die niedrige Geschwindigkeit in Verbindung mit vielen Interrail-Touristen hatte geringe Einnahmen zur Folge. Ab 1991 erhöhten die NSB die Ticketpreise so, als wäre die Strecke 20 Kilometer länger.[43] 1992 nahmen sie in Flåm ein neues Empfangsgebäude in Betrieb.[44] In den 1990er Jahren liehen sie im Sommer X10-Nahverkehrszüge aus Stockholm als zusätzliche Züge aus.[45] Diese Züge der schwedischen Bahngesellschaft Storstockholms Lokaltrafik hatten größere Fenster als die Baureihe 69 und boten somit eine bessere Aussicht.[46]
Im März 1997 gaben die NSB bekannt, dass sie ab 1998 die Privatisierung des Betriebs der Strecke planten. Die Verantwortung für die Festlegung des Fahrplans, den Verkauf von Fahrkarten und das Marketing wurde an Flåm Utvikling übertragen[47], ein neu gegründetes Unternehmen, an dem die NSB zu 49 Prozent und Aurland Ressursutvikling zu 51 Prozent beteiligt waren. Letztere gehört der Gemeinde Aurland, der Norwegischen Industrieentwicklungsgesellschaft und der Aurland Sparebank, einer lokalen Bank.[48] Flåm Utvikling übernahm auch die Verantwortung für andere tourismusbezogene Aktivitäten in Flåm, wie beispielsweise die Hafenanlagen. Die NSB würden weiterhin die Züge betreiben, andererseits würde Flåm Utvikling den NSB die Kosten für den Zugbetrieb erstatten, aber die Gewinne aus dem Fahrkartenverkauf behalten.[47] Die Eisenbahnbehörde Jernbaneverket, die 1996 gegründet worden war und die Verantwortung für die Infrastruktur übernommen hatte, behielt das Eigentum an der Strecke selbst.[48] Flåm Utvikling begann außerdem mit dem Bau eines Kreuzfahrtterminals in Flåm, damit Touristen an Land gehen und direkt zu den Zügen gelangen konnten.[49]

Mit dem Eigentümerwechsel beschlossen die NSB auch, die veralteten El 11 durch El 17 zu ersetzen. Die Lokomotiven waren 1987 ausgeliefert worden und eigentlich für den Schnellzugverkehr vorgesehen, waren jedoch mit technischen Problemen behaftet und galten als nicht zuverlässig genug, um als Einzellokomotiven eingesetzt zu werden. Die sechs neuesten Exemplare dieser Baureihe erhielten eine neue grüne Lackierung und trugen nun den Schriftzug Flåmsbana statt NSB.[50] Ältere B3-Wagen wurden renoviert, mit neuen Panoramafenstern ausgestattet, in derselben Farbgebung lackiert und auf der Strecke eingesetzt.[48] Im Oktober 2000 verkauften die NSB ihre Anteile an Flåm Utvikling an Aurland Ressursutvikling.[47] Seit 1. Mai 2005 ist die Strecke mit GSM-R ausgestattet.[4] Im selben Jahr erklärte die UNESCO den Nærøyfjord, den benachbarten Fjord, an dem Flåm liegt, zum Weltnaturerbe.[51]
Im Spätsommer 2014 wurden die El 17 durch silber und grau lackierte Lokomotiven El 18 2248–2253 ersetzt. Es handelt sich um Anfertigungen des Herstellers Adtranz, die beinahe identisch mit der Baureihe Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen sind.[52] Die Züge werden mit je einer El 18 an jedem Ende bespannt, da keine Steuerwagen verfügbar sind.
Betrieb
Regelbetrieb
Der Betrieb der Flåmbahn ist mittlerweile ausschließlich touristisch orientiert und wird vom staatlichen Verkehrsunternehmen Vy im Auftrag von Flåm Utvikling durchgeführt. Von Mai bis September werden täglich neun oder zehn Fahrten in jede Richtung angeboten, in den übrigen Monaten sind es vier bis fünf. Die Fahrpreise entsprechen nicht den normalen Preisschema von Vy und sind deutlich höher als auf anderen Zugstrecken. Interrail-Tickets ermöglichen einen Rabatt von 30 Prozent. Die Fahrzeit zwischen den Endstationen beträgt zwischen 50 und 59 Minuten.[53]
2006 erstellte Innovasjon Norge einen jährlichen Bericht über die meistbesuchten kulturellen Attraktionen Norwegens; gemäß der darin enthaltenen Liste belegte die Flåmbahn in diesem Jahr den fünften Platz mit 457.545 Besuchern.[54] In den darauffolgenden Jahren verzeichnete die Flåmbahn ein signifikantes Wachstum. Ein neuer Rekord wurde mit 990.000 Besuchern während des Jahres 2017 verzeichnet.[55] Die Bahnfahrt kann auch mit einer Rad- oder Wandertour auf dem Rallarvegen kombiniert werden, der zum Teil der Flåmbahn folgt.[56]
Eine technische Sicherung von Zugfahrten besteht nicht, sie wird einzig durch den Fahrdienstleiter gewährleistet. Im Sommer verkehren zwei Garnituren gleichzeitig, die sich im Bahnhof Berekvam kreuzen. Dabei werden die Weichen von Hand gestellt. Eine Abhängigkeit zu den Einfahrsignalen besteht nicht.[57]
Zwischenfälle
Nach dem Brand der hölzernen Schneeschutz-Galerie Hallingskeid am 16. Juni 2011 auf der Bergenbahn wurden alle hölzernen Schneeschutz-Galerien, darunter die der Flåmsbana, durch Stahlskelett-Bauten ersetzt.[58]
Durch Überschwemmungen am 28. und 29. Oktober 2014 wurden die Bahnanlagen der Flåmbahn schwer beschädigt. Es waren die größten Schäden an der Strecke seit ihrer Eröffnung. Die Strecke blieb rund vier Wochen lang gesperrt.[59]
Am 31. Juli 2019 stießen im Kreuzungsbahnhof Berekvam die mit 800 Fahrgästen besetzten und von den Lokomotiven El 18 2247 und 2250 geführten Züge 1859 und 1860 zusammen, die sich hier hätten kreuzen sollen. Zehn Menschen wurden verletzt, die beiden führenden Lokomotiven und zwei Personenwagen erheblich beschädigt.[57]
Museum

1995 richteten die Norwegischen Staatsbahnen ein Museum und Dokumentationszentrum ein. Ursprünglich befand sich das Flåmsbanamuseet in einem Nebengebäude des Hotels Fretheim, ehe es 1999 in das alte Empfangsgebäude in Flåm umzog.[60] Es dokumentiert die Geschichte der Flåmbahn, die Bauarbeiten, die technischen Herausforderungen und das dörfliche Leben in Flåm. Zu den zahlreichen Ausstellungsobjekten gehört unter anderem die Lokomotive El 9 2063. Das Museum ist täglich geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.[61]
Literatur
- Ivar Gubberud, Helge Sunde: Flåmsbana: historien om en av verdens bratteste jernbaner. John Grieg Forlag, Bergen 1992, ISBN 82-91448-42-6.
- Nils Carl Aspenberg: Elektrolok i Norge. Baneforlaget, Oslo 2001, ISBN 82-91448-42-6.
- Johs. B. Thue: Die Flåmsbana. Skald, Leikanger 1996, ISBN 82-7959-057-9 (deutsche Übersetzung: Ina Petzel).
- Roy Owen: Norwegian Railways – from Stephenson to high-speed. Balholm Press, Hitchin 1996, ISBN 0-9528069-0-8.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Oslo–Bergen og tilknyttede linjer. (PDF) In: banenor.no. 15. Dezember 2024, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ a b Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 125.
- ↑ Thue (1996): Die Flåmsbana. S. 10.
- ↑ a b Jernbanestatistikk 2008. (PDF; 2,4 MB) Jernbaneverket, 2009, S. 42, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ Jernbanestatistikk 2008. S. 38.
- ↑ Thue (1996): Die Flåmsbana. S. 20.
- ↑ a b c d e Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 44.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 40.
- ↑ Thue (1996): Die Flåmsbana. S. 23.
- ↑ a b Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 41.
- ↑ Thue (1996): Die Flåmsbana. S. 34.
- ↑ Thue (2002): Flåmsbana. S. 44.
- ↑ norwaybest.com: Technische Informationen zur Flambahn
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 16.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 19.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 7.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 24.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 25.
- ↑ a b c d e f Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 72.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 26.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 28.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 29.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 32.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 31.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 33.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 34.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 35.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 36.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 39.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 42.
- ↑ a b Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 43.
- ↑ a b c d Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 56.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 57.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 61.
- ↑ a b c d Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 63.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 65.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 75.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 76.
- ↑ a b Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 85.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 86.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 87.
- ↑ a b c Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 83.
- ↑ Gubberud, Sunde (1992): Flåmsbana. S. 110.
- ↑ Flåm bur seg til jernbanefest. In: Bergens Tidende, 14. Mai 1992, S. 6.
- ↑ Thue (1996): Die Flåmsbana. S. 74.
- ↑ Fem ombygde togsett settes ut i trafikk. In: Aftenposten, 10. Juni 1992, S. 3.
- ↑ a b c Arne Hofseth: Flåmsbana blir privat. In: Bergens Tidende, 7. März 1997, S. 4.
- ↑ a b c Flere reiser med halvprivat Flåmsbane. Norsk Telegrambyrå, 13. August 1998.
- ↑ Nyheter notiser. In: Bergens Tidende, 3. Dezember 1997, S. 5.
- ↑ Aspenberg (2001): Elektrolok i Norge. S. 121.
- ↑ West Norwegian Fjords – Geirangerfjord and Nærøyfjord. In: World Heritage Convention. UNESCO, 2025, abgerufen am 24. Oktober 2025 (englisch).
- ↑ Ilkka Siissalo: Norway - electric locomotives. fu.net, abgerufen am 24. Oktober 2025 (englisch).
- ↑ Fahrplan & Info für die Flåmbahn. Norway's best, 2025, abgerufen am 24. Oktober 2025.
- ↑ Attraksjon 2006 report. (PDF; 75 kB) Innovasjon Norge, 2006, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 6. April 2008; abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ Målet til Flåmsbana var ein million reisande i fjor. Hordaland, 6. Januar 2021, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ Rallarvegen – mit dem Rad durch die Geschichte der Bahnarbeiter. Visit Norway, abgerufen am 2. November 2025.
- ↑ a b Rapport om sammenstøt mellom tog 1859 og 1860 på Berekvam stasjon, Flåmsbana 31. juli 2019. Bane rapport 2020/06. In: havarikommisjonen.no. Juni 2020, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ Rapport om jernbaneulykke Bergensbanen, Hallingskeid stasjon 16. Juni 2011, Tog 62. (PDF) JB 2012/05. In: fido.nrk.no. Statens Havarikommisjon for Transport, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch, englisch, Unfalluntersuchungsbericht der staatlichen Unfalluntersuchungsbehörde).
- ↑ Einar Aarre: Flåmsbanen henger i løse luften. In: Aftenposten. 23. September 2015, abgerufen am 24. Oktober 2025 (norwegisch).
- ↑ Thue (2002): Flåmsbana. S. 60.
- ↑ Das Flåmbahn-Museum. Norway's Best, 2025, abgerufen am 24. Oktober 2025.
Auf dieser Seite verwendete Medien
(c) OOjs UI Team and other contributors, MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Tunnel nach rechts
Icons for railway description
Tunnelene rundt Myrdal stasjon, der Bergensbanen og Flåmsbanen møtes. Fra Just Broch: «Av Norges statsbaners historie 5: Jernbaneplanen av 1908: Dovrebanen» (1938), s. 122.
Autor/Urheber: ashfay, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Flåmsbana ved Kjosfossen haldeplass
Autor/Urheber: wassen, Lizenz: CC BY-SA 3.0
El-Lokomotive El 9.2063 als Denkmallok in Flam 13.08.05
Autor/Urheber: Jun Kwang Han, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Flåmsbana ved Vatnahalsen holdeplass
Tunnel mit darunterführender Tunnelstrecke
Track from 1st corner exiting a tunnel
This is Myrdal on february 2010
Autor/Urheber: Tore Sætre, Lizenz: CC BY-SA 4.0
From the Flåm railway
The Flåm Line at Lunden in Aurland, Norway
The Flåm Line near Rjoandefossen
Flåm Line at Melhus in Aurland, Norway
Flåmsbana train at Flåm Station, Norway
Autor/Urheber: Hannob, Lizenz: CC0
Blomheller train station at the Flåmsbana in Norway.
Autor/Urheber: Tomoyoshi NOGUCHI from OSLO, NORWAY, Lizenz: CC BY 2.0
Parti fra Flåm, Aurland.
Map of the Bergensbanen railway, Norway.
NSB El 17 at Flåm Station on Flomsbana, Norway
Tunnel-STRecke links in Gegenrichtung (mit exakten Kreisen)
Autor/Urheber: Tore Sætre, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Kjosfossen Station on the Flåm railway
Myrdal Station
Autor/Urheber: Sam Greenhalgh, Lizenz: CC BY 2.0
Storstockholm Lokaltrafikk X10 electric multiple units were lent out to Norges Statsbaner during summer for service on Flåmsbana, Norway.
An icon of a train.
Tunnel Kreuzung
Autor/Urheber: Tore Sætre, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Myrdal on the Bergen railway. Terminus for the Flåm railway and station on the Bergen railway.
Autor/Urheber: Superbass, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Zugbegegnung der Flåmsbana an der Berekvam stasjon
Autor/Urheber: Andrewofernandes, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Taken from the Train towards Myrdal
Autor/Urheber: Reinhard Dietrich, Lizenz: CC BY-SA 4.0
E-Lok im Flåmsbana Museet, Flåm
Autor/Urheber: Henning Klokkeråsen from Oslo, Norway, Lizenz: CC BY 2.0
Flåmsdalen, Flåm, Norway