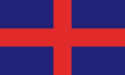Fürstentum Anhalt-Dessau
Territorium im Heiligen Römischen Reich | |
|---|---|
| Anhalt-Dessau | |
| Wappen | |
 | |
| Karte | |
 | |
| Karte von Anhalt | |
| Bestehen | 1396–1863 |
| Entstanden aus | Fürstentum Anhalt-Zerbst |
| Herrschaftsform | Fürstentum ab 1806 Herzogtum |
| Herrscher/ Regierung | Fürst/Herzog |
| Heutige Region/en | DE-ST |
| Dynastien | Askanier |
| Konfession/ Religionen | evangelisch-lutherisch und evangelisch-uniert |
| Aufgegangen in | Herzogtum Anhalt |
Anhalt-Dessau war seit 1396 ein Fürstentum des Herrscherhauses der Askanier im Heiligen Römischen Reich. Es wurde es mehrmals durch Erbteilung reduziert. Seit 1806 souveränes Herzogtum im Deutschen Bund, ging es 1863 im Herzogtum Anhalt auf.
Geschichte
Das Fürstentum entstand 1396 durch Erbteilung des Fürstentums Anhalt-Zerbst in Anhalt-Köthen und Anhalt-Dessau. Im Jahre 1474 kam es zu einer Erbteilung in Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen, zu einer weiteren kam es 1544, hieraus entstanden Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau und Anhalt-Zerbst. Nach dem Tode von Fürst Bernhard von Anhalt-Zerbst war das Fürstentum Anhalt unter Fürst Joachim Ernst von Anhalt-Dessau 1570 unter einem Herrscher vereint. In der Folge des Erbteilungsvertrags der Söhne Fürst Joachim Ernst wurde das vereinigte Fürstentum Anhalt in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen und Anhalt-Zerbst geteilt. 1611 entstand durch Ausgliederung des Amtes Plötzkau aus dem Bernburger Fürstentum das fünfte Fürstentum Anhalt-Plötzkau (unter Landeshoheit von Bernburg).
Das Fürstentum wurde 1806 zum Herzogtum erhoben. Mit dem Erlöschen der Linien in Köthen 1847 und in Bernburg 1863 kam es zum Zusammenschluss der Herzogtümer zu einem vereinigten Herzogtum Anhalt mit Dessau als Hauptstadt.
Landesherren waren die Fürsten von Anhalt-Dessau.
Die archivalische Überlieferung des Fürstentums Anhalt-Dessau befindet sich in der Abteilung Dessau des Landesarchivs Sachsen-Anhalt.
Siehe auch
- Anhalt (Geschichte)
Weblinks
- Schloss Oranienbaum, ab 1683 Sommersitz der Henriette Catharina von Oranien-Nassau, Gemahlin Fürst Johann Georgs II.
- Residenzschloss Dessau (erbaut Anfang 16. Jh.)
- (c) I, Nikater, CC BY-SA 3.0
- Schloss Mosigkau, errichtet 1752–1757 für Prinzessin Anna Wilhelmine
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: David Liuzzo, eagle by N3MO, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Autor/Urheber: David Liuzzo, eagle by N3MO, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
House colours of the House of Habsburg
Flagge Bayerns
Flagge des Königreichs Sachsen; Verhältnis (2:3)
Flagge des Königreichs Württemberg; Verhältnis (3:5)
Flagge der Großherzogtümer Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin; Verhältnis (2:3)
Flagge des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach 1813-1897; Verhältnis (2:3)
Flagge des Herzogtums Anhalt und auch der Stadt Augsburg
Flagge des Herzogtums Sachsen-Coburg & Gotha 1826-1911; Verhältnis (2:3)
Die Einführung der neuen Landesfarben Weiß-Grün erfolgte in Sachsen-Altenburg schrittweise. Schon zum 1. Mai 1823 wurde beim Militär die weiß-grüne Kokarde eingeführt. Die entsprechende Änderung der Beamten-Kokarden (Hofstaat, Forstbeamte, Kreishauptleute usw.) wurde zwischen 1828 und 1832 vorgenommen. Ab 1832 waren die Landesfarben offiziell Weiß-Grün. Fälschlicherweise führte man die Farben einige Jahrzehnte lang häufig auch in umgekehrter Reihenfolge (Grün-Weiß), was eigentlich nicht korrekt war, jedoch nicht weiter beachtet wurde. Ab 1890 setze eine Rückbesinnung auf die richtige Farbenführung ein. Seit 1895 wurde dann im staatlichen Bereich wieder offiziell weiß-grün geflaggt. Im privaten Bereich zeigte man häufig auch danach noch grün-weiße Flaggen. Die richtige Reihenfolge der sachsen-altenburgischen Landesfarben lautet jedoch Weiß-Grün. Auf zahlreichen Internetseiten werden die Landesfarben Sachsen-Altenburgs noch heute unrichtig mit Grün-Weiß dargestellt. Auch manche Texte dazu sind fehlerhaft. Quelle: Hild, Jens: Rautenkranz und rote Rose. Die Hoheitszeichen des Herzogtums und des Freistaates Sachsen-Altenburg. Sax-Verlag, Beucha, Markleeberg 2010
Flagge des Herzogtums Braunschweig; Verhältnis (2:3)
Flagge des Fürstentums Lippe; Verhältnis (2:3)
Flagge des Fürstentums Reuß ältere Linie; Verhältnis (27:34)
Flagge des Fürstentums Reuß jüngere Linie; Verhältnis (4:5), oder auch (5:6)
Flagge des Fürstentums Schaumburg-Lippe; Verhältnis (2:3), c. 1880–1935
Flagge der Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt; Verhältnis (2:3)
Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.
Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt.
Dienstflagge für Einrichtungen des Staates, Elsaß-Lothringen, 1891-1918, Deutsches Kaiserreich
Flagge Liechtensteins (1852-1921)
(c) Pischdi, CC BY-SA 3.0
Deutscher Zollverein in den Grenzen des Deutschen Bundes 1834 (rot) mit für den Zollverein relevanten Außengrenzenänderungen (Schleswig, Luxemburg, Elsaß-Lothringen) in hellrot. In blau die Beitrittsstaaten 1834, grün weitere Beitritte bis 1866, gelb Beitritte nach 1866. Größere Staaten des Zollvereins sind beschriftet.
coat of arms of Anhalt-Dessau-Cöthen
Autor/Urheber: User:Kalan, User:F l a n k e r (crown), Lizenz: CC BY-SA 2.5
Flag of Hanover during 1837—1866.
Flag of the Principality of Reuss-Lobenstein
Flagge des Großherzogtums Hessen ohne Wappen; Verhältnis (4:5)
Schloss Mosigkau Gartenseite
Flag of the Principalities of Hohenzollern-Hechingen and Hohenzollern-Sigmaringen, flag found on Dutch Wikipedia [1].
Civil flag of Oldenburg, before 1871 and beween 1921 and 1935
Autor/Urheber: Mrmw, Lizenz: CC0
Proposed flag for the Duchy and Province of Limburg, The Netherlands. Never officially approved.
Autor/Urheber: Sir Iain, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Karte von Anhalt zwischen 1747 und 1793, zwischen dem Kauf des Amtes Alsleben durch Anhalt-Dessau und dem Aussterben des Hauses Anhalt-Zerbst.
Dessau, (Deutschland) - Schloss. Am 7. März 1945 wurde das Schloss im Zweiten Weltkrieg beim 19. und schwersten Luftangriff auf Dessau durch Spreng- und Brandbomben schwer beschädigt, Ost- und Südflügel nahezu vollständig zerstört. Die schwer beschädigten Flügel wurden später gesprengt. Der Johannbau blieb als schwer beschädigte Ruine erhalten und noch während der DDR-Zeit unter Denkmalschutz gestellt
Autor/Urheber: Michael Sander, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Das Schloss in Oranienbaum (Sachsen-Anhalt).